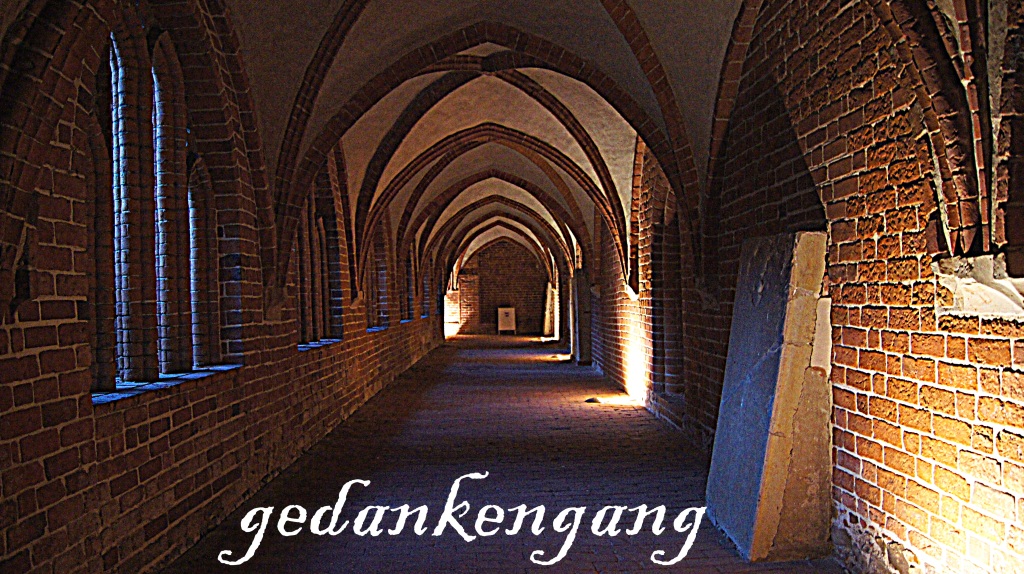
1
Im Sommer 1967, zwischen dem Sechs-Tage-Krieg und meiner Armeezeit, arbeitete ich in der Berliner Stadtbibliothek als Magazinarbeiter. Der Sechs-Tage-Krieg fiel mit unserem Abitur zusammen. Ich wollte unbedingt noch etwas Geld verdienen. Der eigentliche Gewinn dieser schönen, drei Monate währenden Arbeit, lag aber darin, dass ich jeden Tag ein Buch las, denn zu den Pausen kam, als unverhoffte Lesezeit, die durch den Mauerbau höchst umständliche S-Bahn-Fahrt mit dem Berliner Außenring. Eines Tage lautete ein außerplanmäßiger Auftrag, Bücher aus dem benachbarten Staatsratsgebäude und dem wenige Meter weiter befindlichen ZK der SED zu holen. Unter Bewachung schwerbewaffneter MfS*-Soldaten fuhren wir mit unserm Wägelchen auf dem breiten Bürgersteig und über die Breite Straße in Ostberlins Mitte. Das Staatsratsgebäude gab es erst seit drei Jahren, während das ZK-Gebäude eine ebenfalls kurze, aber doch schon sehr bewegte Geschichte hinter sich hatte. Es wurde als Erweiterungsbau der Reichsbank geplant und gebaut. Um den Architekturwettbewerb rankt sich die Legende, dass ihn Hitler selbst zuungunsten der weltberühmten Architekten um Gropius, Mies van der Rohe und Hans Poelzig entschieden hatte. Auf der konservativen Seite bewarb sich Heinrich Tessenow aus Neubrandenburg. Wahrscheinlicher aber ist, dass der Kompromisskandidat, der Hausarchitekt der Reichsbank, Heinrich Wolff, sich mit seinem Kompromissvorschlag der gemäßigten Moderne durchsetzte. Zur Grundsteinlegung mit Hitler kamen 6000 geladene Gäste. Legendär waren (oder sind?) die flutbaren Tunnelsysteme unter und neben dem Gebäude, die der Sicherung der Gold- und Geldreserven dienen sollten. Erst 1959 zog in das Haus am Werderschen Markt, den es gar nicht mehr gibt, das Zentralkomitee der SED ein. Um den Sitzungssaal seines Politbüros, der eigentlichen Machtzentrale der DDR, ist nun ein absurder Streit entstanden. Vielleicht hat der erste in diesem Haus residierende gesamtdeutsche Außenminister, Klaus Kinkel, FDP, vorgeschlagen, diesen weiter als Sitzungssaal genutzten Raum nach dem Gründer des Auswärtigen Amtes, Bismarck, zu benennen. Die jetzige Ministerin, Annalena Baerbock von den Grünen, hat ihn in Saal der deutschen Einheit umbenannt, vielleicht in Erinnerung, dass er einst Saal der deutschen Zweiheit war. Die rechte Grünenschelte macht nun daraus eine Abkehr vom Gesamterbe. Weder der Saal noch das Gebäude hat irgendetwas mit Bismarck zu tun. Es gibt in Deutschland rund 500 Bismarckdenkmäler und 150 Bismarcktürme. Der Bismarckturm in Frankfurt an der Oder wurde 1945 von der Wehrmacht gesprengt, während der Bismarckturm auf der Porta Westfalica hoch über der Autobahn A2 thront, wie jeder weiß. Um das Erbe Bismarcks muss sich also niemand Sorgen machen, zumal die von ihm begründeten Sozialversicherungen ein absolutes Markenzeichen Deutschlands sind. Jeder Sozialkundelehrer betont und erklärt das unzählige Male. Diese Würdigung als Schöpfer eines Sozialsicherungssystems ist aus heutiger Sicht mehr wert als weitere Denkmäler, Türme und Säle. Allerdings hat Bismarck noch eine zweite bemerkenswerte, jedoch dunkle Seite: das Sozialistengesetz, beide sind eng verflochten. Dabei geht es nicht um die Sozialdemokratie, die sogar gestärkt aus der Unterdrückung hervorging, sondern um die Unterdrückung als Instrument autoritärer Herrschaft. Obwohl Bismarck die Katholiken im von ihm entfachten Kulturkampf als seine Feinde betrachtete, übernahm er den autokratischen Grundsatz von Papst Pius IX.: Wenn sich jemand — was Gott verhüte — herausnehmen sollte, dieser unserer endgültigen Entscheidung zu widersprechen, so sei er ausgeschlossen. Die Exkommunikation ist seither – auch in ihrer passiven Form als Migration – ein beliebtes Mittel aller Autokraten. Wir erinnern uns noch an den berüchtigten Satz Erich Honeckers, wahrscheinlich in diesem Gebäude, vielleicht sogar in diesem Saal formuliert, aus dem Jahr 1989: Wir weinen ihnen keine Träne nach. Ähnlich äußerte sich auch der eritreische Diktator Isaias Afwerki angesichts des Massenexodus von mehr als einer Million junger Menschen aus seinem winzigen und bettelarmen Land.
Kein Mensch und kein Geschehen hat nur eine Seite. Früher nahm man die beiden Seiten von Münzen als Metapher dafür, heute wissen wir, dass auch Münzen eher tausend als nur zwei Seiten haben. So ist es auch mit dem von vielen Menschen zurecht verehrten Preußenkönig Friedrich II. Er brachte die Aufklärung und die Kartoffel, aber auch Kriege und Hegemonialstreben. Aus seiner gegen absolutistische Autokraten gerichteten Schrift Anti-Machiavell zitieren wir gerne den Satz, dass der König der erste Diener seines Staates sein soll. Darin steht aber auch, dass Politiker gerne glauben machen wollen, dass Politik und Moral unvereinbar und demzufolge List, Verrat und Eidbruch erlaubt seien.
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, Spross eines Professorenehepaars, studierte ordentlich Jura, um dann aber Schauspieler, Komödiant, Komiker, comedian zu werden. Den größten Erfolg hatte er mit der Hauptrolle in der Seifenoper Слуга народу, zu Deutsch: Diener des Volkes. Darin spielt er einen Geschichtslehrer, der sich über die Verlogenheit und Korruption in seinem Land aufregt und dabei unversehens zum Präsidenten wird, der gegen die Verlogenheit und die Korruption ankämpft und sich damit in die Herzen seines Volkes dient. Kurze Zeit darauf hat sich Selenskyj tatsächlich als Präsidentschaftskandidat aufstellen lassen und hat mit über siebzig Prozent gegen den staunend-verzweifelnden Amtsinhaber Poroschenko gewonnen. Seither kämpft er gegen Verlogenheit und Korruption und wird immer beliebter, weil kompetenter. Allerdings muss man auch sehen, dass vor knapp einem Jahr der Ukrainekrieg Russlands in seine heiße Phase einstieg und sich hier Selenskyjs Führungsqualitäten erst richtig entfalten konnten. Legendär ist seine Antwort auf US-Präsident Bidens Angebot, ihn aus Kyjiv** ausfliegen zu lassen: I need ammunition, not a ride. Über die Umkehrung des Verhältnisses von Politiker und Imitator haben wir schon zweimal in Bezug auf Chaplin und Hitler geschrieben. Allgemein wird angenommen, dass der Film Der große Diktator, in dem Chaplin sowohl den jüdischen Friseur im Ghetto als auch den Diktator Hynkel spielt, eine Hitlerparodie sei. Das ist der Film auch sicher und grandios. Aber es gilt auch das umgekehrte: der kinobegeisterte arbeits- und obdachlose Hitler sah den Tramp oft im Kino und nahm ihn sich zum Vorbild. Er wollte der einfache, unbedarfte Mann aus dem Volk sein, der erst vom Pech verfolgt, dann aber ein Diener des Volkes wird. Statt dessen hat er aber die Komikerstaffage als Tarnung seines durch List, Verrat und Wortbruch gekennzeichneten Politikstils übernommen.
Das ist auch Putins Politikstil. Und auch er stammt aus einer Fernsehserie: sein Vorbild ist der fiktive KGB-Agent Max Otto von Stierlitz alias Wsewolod Wladimirowitsch Wladimirow. Der Zusammenhang zwischen Putin und dieser sowjetischen Kultfernsehfigur der siebziger Jahre wird am besten durch einen Witz aus dieser Serie charakterisiert: In Hitlers Bunker kommt ein Mann und schenkt Tee ein, Hitler fragt Gestapochef Schellenberg, wer das war, Schellenberg antwortet, das war Stierlitz aus meiner Abteilung, in Wirklichkeit ist er aber ein russischer Agent: Oberst Issajew, Hitler fragt: und warum verhaften Sie ihn dann nicht? Schellenberg antwortet: das bringt nichts, er wird sich herauswinden und sagen, er hätte nur Tee gebracht.
Putin hat das anhand des von ihm erfundenen Bedrohungsszenarios durch die NATO vorgeführt. Der einstige US-Außenminister James Baker (unter Präsident Bush senior) hat tatsächlich während der Deutschland-Verhandlungen 1990 gesagt, dass sich die NATO keinen inch nach Osten bewegen wird. Aber: da existierte der Warschauer Pakt noch fast zwei Jahre und niemand hat auf diese Bemerkung geachtet und sie ist nirgendwo verhandelt oder in Verträge aufgenommen worden. Nachdem sich der Warschauer Pakt Ende 1991 aufgelöst hatte, erinnerten sich die nun selbstständigen Staaten des ehemaligen Einflussbereichs der Sowjetunion – die es nun auch nicht mehr gab – an die fortwährende Bedrohung durch Russland, das es nun plötzlich wieder gab. Sie drängten also nach Westen unter das Dach der NATO und der EU. Das fand Putin 2004 in einer Pressekonferenz mit dem damaligen Bundeskanzler Schröder nicht problematisch, im Gegenteil, er lobte die neue Stufe der Zusammenarbeit zwischen der NATO und Russland im neugeschaffenen NATO-Russland-Rat. Des Rätsels Lösung ist also, dass der Jelzin-Nachfolger Putin weder den Zusammenbruch der Sowjetunion noch den des Warschauer Paktes hat verarbeiten können. Im Gegenteil: er spielt mit der Großmachtsehnsucht seines nicht im Wohlstand lebenden Volkes. Wohlstand braucht keinen Nationalismus. Deshalb sucht er jetzt immer wieder nach neuen Begründungen für seinen wahnsinnigen und auch erfolglosen Krieg. Er behauptet, die NATO rücke bedrohlich näher, tut aber alles, damit die NATO tatsächlich näher rückt (Schweden, Finnland).
2
Keine Person, so wissen wir alle, und kein Geschehen kann aus einem einzigen Grund erklärt werden. Die berühmte Frage wem nützt es? hat auch eine berühmte Antwort der ist es gewesen!, denn sie stammen beide aus einem Strafprozess. Wem irgendetwas nützt ist ein Aspekt einer Sache, aber oft nicht der oder noch nicht einmal ein Grund. Wer also glaubt, dass, da die Gaslieferungen nun auch aus den USA kommen, die USA der Nutznießer des Krieges und demzufolge auch sein Verursacher sei, ist mindestens einer Verkürzung aufgesessen, wenn nicht einer Verschwörungstheorie, man denke an den 11. September 2001 (nine eleven). Die Frage wem nützt es? sucht nicht eine Erklärung, sondern einen Schuldigen. Trotzdem wollen wir sie einmal für die Argumentation zulassen. Dann stellt sich heraus: die Abhängigkeit Europas vom russischen Gas (zu 50%) und Erdöl (zu 30%) nützte unserer Gier nach billigen und fossilen Rohstoffen für die Energie. Der niedrige Preis ergibt sich aus unserem tief verwurzelten Glauben an das Geld. Gleichzeitig hat die billige Energie unsere gravierenden Wettbewerbsnachteile gegenüber den USA und China, zum Beispiel mangelnde Innovation, kompensieren können. Wir hingen an den fossilen Rohstoffen, weil wir nicht glauben, dass wir gerade dabei sind, die Lebensgrundlagen der Menschheit zu zerstören. Der Wohlstand für immer mehr Menschen hat ein enormes Wachstum der Weltbevölkerung gebracht, allein in unserer Zeit drei Verdopplungen: von zwei auf vier, von drei auf sechs und schließlich von vier auf acht Milliarden Menschen. Dieses Wachstum wird erst in der Mitte des Jahrhunderts enden, wenn – und auch nur falls – der Wohlstand so hoch ist, dass zu seinem Erhalt nicht mehr Kinder als Erwachsene notwendig sind. Die vielen Menschen können aber mit Nahrung und Energie versorgt werden, allerdings nicht durch Verbrennung und ungehinderten Ressourcenverbrauch.
Der Krieg hätte tatsächlich verhindert werden können: wenn wir das alles bei Putins Machtantritt beachtet hätten, statt dessen haben wir ihn gewähren lassen, nicht einmal aus Appeasement-Gründen, denn Georgien, Ossetien, Abchasien, Transnistrien, Tschetschenien, Donbass, Luhansk und Krim waren uns gleichgültig, sondern aus Gier und Eigennutz. Wem nützte das alles: UNS, bis das System aus Eigennutz, Gier und Unverstand zusammenbrach. Damit keine Missverständnisse aufkommen, wiederhole ich, dass der Kapitalismus zwei Seiten hat: Maximalprofit und Maximalkonsum.
Das linke Abonnement, im gesamten Ostblock war die Frage Standard, auf die Wem nützt es?-Frage kam wohl durch den kommunistischen Medien-Guru Willi Münzenberg (‚der rote Millionär‘), der sie in seinem Braunbuch vom Reichstagsbrand nicht nur benutzte, sondern ihr die allerhöchste Priorität einräumte. Er rückte in diesem hoch verdienstvollen Braunbuch auch von der Klassenkampftheorie ab und ersetzte sie mit einem Kriminalroman über die Nazi-Führung, der wahrscheinlich ziemlich realistisch war. Im Reichstagsbrand, dem Braunbuch und dem Prozess kann man das Ringen zweier Verschwörungstheorien nach der Wem nützt es?-Frage beobachten. Der Reichstagsbrand nützte den Nazis und er nützte den Kommunisten, und wir wissen immer noch nicht, wer den Reichstag angezündet hat. Die Beantwortung dieser Frage, wir wiederholen es, bringt selten eine Erklärung, oft aber einen Schuldigen, noch öfter einen vermeintlich Schuldigen zum Vorschein.
In der Logik kann der einseitigen Betrachtung durch die cui-bono-Frage auch mit dem Trugschluss des cum hoc ergo propter hoc widersprochen werden: zwei Ereignisse, die gleichzeitig auftreten, müssen deshalb nicht verbunden sein, schon gar nicht kausal. Der amerikanische Soziologe David A. Baldwin hat das mit den Taxifahrern erklärt, die vom Regen profitieren, ohne für ihn verantwortlich zu sein. Mir scheint dieser immer wieder beliebte Trugschluss verwandt zu sein mit dem Scholllatourismus nach dem einst omnipräsenten Fernsehjournalisten Peter Scholl-Latour, der aus seiner Anwesenheit an einem bestimmten, meist kritischen Ort seine Kompetenz, die dortigen Ereignisse erklären zu können, herleitete. Von ihm stammen berüchtigte und auch leider langlebige Vorurteile, wie zum Beispiel das Kalkutta-Paradox oder die Ansicht, dass der Islam an sich menschenfeindlich sei. Vorurteile sind leichter zu erlangen als Urteile und halten sich länger als diese. Und obwohl Verurteilungen schon in der Bibel verurteilt werden, halten so viele Menschen an ihrer Berechtigung und scheinbaren Kompetenz dafür fest.
Warum aber kann der Krieg nicht mit UNO-Soldaten gestoppt werden? Russland hat als Siegermacht des zweiten Weltkrieges, als Signatarmacht der UNO und als Nuklearmacht im UNO-Sicherheitsrat ein Vetorecht, das es genauso oft ge- und missbraucht hat wie die anderen vier Vetomächte. Die Gegner der Waffenlieferungen übersehen, dass diese ein traditionelles Mittel für den jeweils unterlegenen und überfallenen Kriegsteilnehmer sind. Durch Waffen- und Logistiklieferungen wurde der Sowjetunion im zweiten Weltkrieg geholfen, Südkorea im Koreakrieg, Nordvietnam im Vietnamkrieg (auf dessen Gegenseite immerhin erst Frankreich und dann die USA standen), Bosnien im Jugoslawienkrieg, Kosovo im Kosovokrieg und nun der Ukraine im Ukrainekrieg. Was ist daran nicht zu verstehen? Russland will seine wirtschaftliche Schwäche, die es nicht eine wirkliche Großmacht sein lässt, hinter nationalistischen und kolonialistischen Großmachtfantasien verbergen. Russland ist bevölkerungsmäßig doppelt so groß wie Deutschland, hat aber ein Bruttoinlandprodukt, das nur halb so groß ist. Jeder weiß, dass es sich zu wahrscheinlich achtzig Prozent aus Rohstoff- und Lebensmittellieferungen speist. Russland ist technologisch ein Entwicklungsland. Das viele Geld, das es durch Erdöl und Gas verdient, verschwindet bei den Oligarchen oder in anderen korrupten Kanälen. Wahrscheinlich weiß das niemand. Ich erinnere an die 100 Millionen US-Dollar, die Putin zur Verfügung gestellt hatte, um in der Ukraine, vor dem Angriff, Agenten und Claqueure anzuwerben, die die russischen Truppen, unter anderen die Fliegerstaffel der Luftlandeoperation auf dem Flugplatz Kiew-Hostomel und den 60-km-Konvoi in Richtung Kiew, begrüßen sollten. Bekanntlich stand da kein einziger agent provocateur, der Flugplatz wurde nicht eingenommen, der Konvoi kam nicht an. Bis zum 23. Februar des vorigen Jahres haben wir wohl alle angenommen, dass die russische Armee, wenn schon nicht die zweitstärkste der Welt (wie in dem ukrainischen Witz, dass sie jetzt dafür die zweitstärkste in der Ukraine ist), doch eine sehr starke, große und schlagkräftige Armee sei. Nun zeigt sich, dass ihre ganze Stärke lediglich in der schieren Menge schlecht ausgebildeter Soldaten besteht. Putin droht mit Waffen, die als Prototyp bestehen mögen, von denen es aber keine in der kämpfenden Armee gibt. Dutzende Generäle sind gefallen, jeden Tag sterben geschätzt 800 Soldaten, der dritte Oberkommandierende soll jetzt das Kompetenzchaos richten, das bisher Putin genützt hat (!), nun aber dem Krieg und dem Sieg schadet. Russland wird diesen Krieg nicht gewinnen. Im schlimmsten Fall wird es auseinanderbrechen, im besten Fall kommt es zu einem Kompromiss wie nach dem Winterkrieg gegen Finnland. Wir erinnern uns, dass wir schon einmal den sowjetischen General zitiert haben, der das Ende des Winterkriegs mit folgenden Worten kommentierte: Wir haben gerade soviel Land gewonnen, dass wir unsere gefallenen Soldaten darauf beerdigen können. Schon jetzt sind der Donbass und Luhansk so weit zerbombt und geschunden, dass noch nicht einmal die Post funktioniert. Der Donbass war einst das Ruhrgebiet oder die Wallonie der Sowjetunion. Mariupol am Schwarzen Meer wurde erobert, aber es existiert nicht mehr, so wie Karthago nach dem dritten Punischen Krieg nicht mehr existierte. Wem nützt das?
Niemand weiß, wie dieser Krieg ausgehen wird, jede Seite spekuliert zu ihren Gunsten. Aber das darf niemanden hindern, kein Land und keinen Menschen, denjenigen zu helfen, die in Bedrängnis sind. Ich finde es merkwürdig, wenn ganze Theorien ausgedacht werden, warum damals Bosnien und heute die Ukraine keiner Hilfe würdig sind. Wer kann und will über Tod und Leben entscheiden?
3
Wer nicht will, dass mit seinem Geld etwas getan wird, was er oder sie nicht will, muss die Partei wählen, die sein oder ihr Geld in seinem oder ihrem Sinne verwendet. Das ist sowohl ironisch gemeint als auch realistisch: die linke Partei hat in der letzten Bundestagswahl 4,9% der Wählerstimmen erhalten, die andere Alternative 10,3%. Damit kann keine der beiden Parteien regieren, wenn sie sich noch dazu so verhalten, dass die anderen Parteien mit der einen nicht koalieren können, wegen der Nähe zum Rechtsextremismus, mit der andern nicht wollen, wegen des ständigen Taktierens, Spaltens und Hetzens.
Ihren Wählern oder auch den Nichtwählern bleibt wohl nur zu schimpfen. Mit der Politikerschelte, die selbstverständlich unter die Meinungsfreiheit fällt, aber nicht produktiv ist, begann übrigens der Auflösungsprozess des Konsenses nach dem Ende des Kalten Krieges. Dem einen Politiker wird vorgeworfen, dass er nichts tut, dem anderen, dass er übereifrig ist, die eine ist inkompetent, die andere hat den falschen Beruf, der nächste verdient zu viel oder kauft zu teure Häuser, der wieder nächste verschwendet Steuergelder. Letztendlich steckt dahinter das Unbehagen an der Demokratie. Statt sich wenigstens in die Kommunalpolitik einzubringen und dort an Entscheidungen teilzunehmen, verbleibt man im Empörungsmodus. Empörung gibt einem das gute Gefühl, etwas erkannt zu haben, etwas getan zu haben, auf der richtigen Seite zu sein. Man scheint auch wissender als man ist. Der größte Teil der Empörung speist sich aus puren Behauptungen. In der sechzehn Jahre währenden Kanzlerschaft von Angela Merkel konzentrierte sich ein Großteil der sich sogar schon formierenden Empörung (Pegida, dann AfD) im Osten Deutschlands. Dafür gab es verschiedene Erklärungsansätze: die Ostdeutschen hätten sich noch nicht aus der Diktatur hinauswinden können, sie seien staatsgläubiger als die Westdeutschen, sie hätten ein besonderes Verhältnis zu Russland. Tatsächlich ging die besondere Russlandpolitik bereits von den Kanzlern Kohl und Schröder aus und wurde von Merkel nur fortgeführt. Die Pegida hatte ihren Ursprung tatsächlich in Dresden, die AfD dagegen hatte immer Führer aus dem Westen. Chrupalla ist der erste autochthone Ostbürger. Wahrscheinlich aber spielt die Herkunft, wie auch in anderen Bereichen, gar keine herausragende, vielleicht sogar gar keine Rolle. Empörung ist einfach von allen Aktivitäten die passivste, die trotzdem ein gutes Gefühl erzeugt: man muss nichts tun und ist trotzdem richtig.
Demokratie, Säkularisierung, Globalisierung rütteln tatsächlich an den Grundfesten der alten Welt. Aber sie stammen nicht von Aliens vom Mars. Die Globalisierung begann, wenn man solche Großereignisse überhaupt an einem Datum festmachen kann, 1444, als das erste Schiff mit Sklaven aus Afrika nach Europa unterwegs war. Die Religionen, die jetzt beklagen, dass ihnen die Menschen abhandenkommen, erklärten die Afrikaner für Nichtmenschen, damit sie entwürdigt und verwertet werden konnten. Allerdings muss man zur Ehre der Christen sagen, dass der Abolitionismus auch von Klerikalen in Portugal (Marques de Pombal), Großbritannien und den USA ausging. Jedoch spielte dabei auch die Aufklärung und die Ökonomie eine große Rolle. Die Aufklärung begann, wieder so ein Datum, am 2. November 1755, als Lissabon in einem Erdbeben, einem Tsunami und einem Großbrand zerstört wurde und der Kanzler Marques de Pombal sagte: Begraben wir die Toten und bauen wir die Stadt wieder auf. Die Religionen verharrten, statt darauf zu reagieren, in der Hoffnung, dass sie immer Staatskirche bleiben und der Glaube sozusagen polizeilich garantiert würde, so wie in Deutschland heute noch die Kirchensteuer ein Teil der Lohnsteuer ist. Die Säkularisierung führt also zur Demokratie, nicht zur Diktatur, allerdings auf langen, verschlungenen und widersprüchlichen Wegen. Immer noch ist die Sinuskurve die beste Abbildung dafür. Demokratie ist auf schicksalhafte Weise mit Wohlstand verbunden, und beide sind nie erreicht, sind asymptotisch. Die Coronakrise hat gezeigt, wie schnell viele Menschen in den Krisenmodus zurückfallen können. Beim ersten Lockdown wurde gehamstert, in der Folge gab es kein Klopapier (dummes Horten) und keine Hefe (schlaues Horten). Unter schlauem Horten verstehen wir die Parallele zum schlauen Bettler: er kauft sich Brot und ein Buch Wie werde ich Millionär?
4
So wie die von Darwin beschriebene Evolution die Geduld der Natur vorschreibt, die aber kein Ziel und kein Ende hat, so ist die Demokratie die fast unmögliche Geduld ausgerechnet derjenigen Menschen, die Individualisten in einer bis vor kurzem unvorstellbar großen Menge, die durch Globalisierung aber eng verbunden und in einem ständigen Austausch befindlich, durch Säkularisierung aber ihrer bisherigen Wegweiser verlustig gegangen sind. Der berühmte Kierkegaard-Satz, dass wir vorwärts leben müssen, das Leben aber nur rückwärts verstehen können, ist beinahe noch zu optimistisch, denn wir können vieles historisch auch nicht richtig verstehen, weil wir immer zu viel Vernunft und Logik in unendliche Mengen von zufälligen Ereignissen hineininterpretieren. Vernunft und Logik sind nicht Triebkräfte der Geschichte, sondern Elemente ihrer Beschreibung. Außerdem interpretieren wir die Wirklichkeit mehr in ihren ikonografischen Dimensionen als nach tatsächlichen Ereignissen, die uns nach wie vor nicht zugänglich sind, die nicht verborgen werden, sondern verborgen sind. Je mehr Bilder es gibt, desto mehr werden sie für die Wirklichkeit gehalten. Das Goldene Kalb, das einen sichtbaren Gott einem unsichtbaren vorzog, ist wieder einmal Wirklichkeit geworden.
Wir werden nicht mehr von charismatischen Führern geführt, sondern von enigmatischen Bürokraten, die einerseits allwissend sind, andererseits uns immer wieder befragen, ob wir noch da sind, wieviel wir verdienen und ob wir noch zu Transparenz und Kooperation bereit sind. Die Bürokratie selbst verbirgt sich hinter Öffnungszeiten und Inkompetenzen. Das beste Beispiel dafür ist die Verwaltung der Bundeshauptstadt und des Landes Berlin, allein schon diese Doppelfunktion ist ein bürokratisches Monster. Man muss aber auch sehen, dass wir einerseits den Mangel an Vereinfachungen und Digitalisierungen beklagen, andererseits aber am Bargeld kleben. Kein Wunder also, dass hinter all den unverständlichen und unlogischen Erscheinungen ein böser oder guter Geist vermutet wird, der sowohl Gott abgelöst hat als auch den Despoten, dem man dankbar sein oder den man verfluchen konnte (‚Der Bauer an seinen durchlauchtigen Tyrannen‘). Die meisten Menschen in den gegenwärtigen großen Demokratien haben lange und mit großem Unverständnis auf die Sehnsucht nach charismatischen und allwissenden Führern herabgeblickt, ohne zu bemerken, dass sie selbst überall den Weltgeist, das Unglück, das Böse, die Vernunft, die Unvernunft, die Ungerechtigkeit, die Ungleichbehandlung, den unermesslichen Reichtum, die unverschuldete Sklaverei, die Zunahme des Verbrechens und so weiter vermuten.
Jede neue Sicht wird beargwöhnt. Die alten Feinde der Menschheit Rassismus, Klassismus und Sexismus glaubt man fern. Gendern erscheint so gesehen als unverständlicher, despotischer Eingriff in die angeblich eigene Sprache, in die vermutete Intimsphäre. Die Diskriminierung des anderen wird billigend in Kauf genommen. Das ändert sich, wenn man sich in den Schönhauser Allee Arkaden mit einer Frau trifft, die man früher als junger Mann kannte. Dann beginnt man zu überlegen, wer, wie, was ist. Ebenfalls in Berlin, im Alten Museum, gegenüber vom Haus am Werderschen Markt, steht der so genannte Berliner Hermaphrodit. Er ist knapp zweitausend Jahre alt und zeigt, wie alt das Problem und wie schön man schon früher damit umgegangen ist: sexuelle Identität ist fragil. Wir haben das große Glück, in einer Zeit zu leben, in der winzigen Minderheiten die umfassende, längst überfällige Würde zurückgegeben wird, denn wir können vermuten, dass Diskriminierung oder Segregation Zutaten von Herrschaftsmechanismen der staatlichen und religiösen Ordnungen und Ideologien waren und sind.
Hinter jeder Umbenennung wird demzufolge auch eine banal-böse Macht vermutet und nicht etwa einfach neue Erkenntnisse. Wer zum Beispiel beobachtete, dass die Greifswalder Universität ihren Namen abgelegte, kann das als Abschütteln der Nazivergangenheit deuten oder als Distanzierung von wichtigen Traditionen. Aber alle Traditionen sind historisch, sie kommen und vergehen und sie werden, solange sie da sind, maßlos überschätzt, wenn sie aber verschwanden, schnell vergessen. Deshalb erklären autokratische Staatsysteme jedes zweite Ereignis zur tausendjährigen Tradition. Das Alter einer Universität hat nichts mit dem Namen zu tun, zumal wenn er erst vor kurzem von fragwürdigen Gestalten verliehen wurde. Die Greifswalder Universität verdankt ihren nun abgelegten Namen den Nazis und die Ablegung einem Beschluss des Senats und einer Befragung der desinteressierten Studenten, was sich in der äußerst geringen Wahlbeteiligung zeigte. Was sagen die Pommern dazu? Die Pommern sagen dazu nichts, weil sie schon lange nicht mehr wissen und wissen wollen, wer Ernst Moritz Arndt war. In Greifswald leben auch nicht nur Pommern und schon gar nicht nur geschichtsinteressierte Pommern. In Greifswald lebte vor vielleicht fünfzehn Jahren eine afrodeutsche Bratschistin, die im Stadttheater arbeitete und von einer rassistischen Kellnerin nicht bedient wurde. Aber das ist lange her und zeigt jedoch, wie übel lange Traditionen wirken. Natürlich ist niemandem (von wem auch?) verboten, Pommern zu sagen oder zu lieben. Selbst in der DDR war es nicht verboten, aber unerwünscht. Statt dessen sollte man sagen, man lebe im Bezirk Rostock oder im Bezirk Neubrandenburg. Dieser – aber auch nicht gewaltsame – Eingriff wirkt bis heute nach, so dass Menschen in Pommern glauben, dass sie nicht in Pommern leben oder nicht Pommern sind. Aber vielleicht neunzig Prozent aller Menschen interessieren sich nicht dafür. Pommern als Identität war wichtig, solange die meisten Menschen lebenslang in ihren Dorf sozusagen gefesselt waren, gefesselt durch Familie, Arbeit, Tradition, Unwissenheit, vor allem mangelnde Navigation. Statt dessen ist in einer Demokratie alles erlaubt, was nicht ausdrücklich verboten ist, wie zum Beispiel das Hakenkreuz, weil es in Deutschland eben nicht ein altindisches Sonnensymbol ist, sondern weil bei uns bis auf den heutigen Tag die einseitige Interpretation als Kennzeichen einer rassistischen und militaristischen Diktatur vorherrscht. Es ist auch nicht verboten (von wem auch?), Menschen aus Afrika als Neger zu benennen. Nur zeigt man damit, dass man in letzter Zeit nicht viel verstanden hat. Nicht erlaubt ist dagegen, die Würde eines Menschen ‚anzutasten‘, wie es im Grundgesetz heißt.
Andererseits kann durch ein Gesetz, so falsch oder unpopulär es auch immer dem einzelnen erscheinen mag, keine jahrtausendealte Identität zerstört werden, weil es die nicht gibt. Nationen etwa begannen sich erst im 18. Jahrhundert herauszubilden, und sie sind immer ein zweifelhaftes Konstrukt [Ernest Renan]. Identitäten und Definitionen sind ebenso historisch wie fragil, fragwürdig und zweifelhaft. Definitionen sind meist tautologische Plattitüden, Identitäten dagegen gleichen eher idealisierten Wunschbildern. Da alles in Bewegung ist, sind Definitionen so falsch wie Tatortfotografien. Nichts ist mit etwas anderem identisch, noch nicht einmal mit sich selbst.
Ob jemand sein Dorf, zunehmend auch seine Stadt, eine Region, ein Land, vielleicht sogar eine Nation oder einen ganzen Kontinent, wie viele Afrikaner tun, als seine Heimat festlegt, kann der- oder diejenige nur selbst wissen. Bei vielen Menschen ändert sich das auch. Seit eh und je, und auch heute noch, gibt es Nomaden und Sesshafte und tausend Zwischenformen. Migration kann ein Ziel haben (Amerika), kann aber auch nur Flucht sein. Sesshaftigkeit kann ein Ausdruck von Treue und Loyalität sein oder aber einfach Dummheit (‚stupid economy‘).
5
Obwohl ich selbst immer die Multikausalität beschrieben habe (jedes Ereignis hat tausend Gründe, jedem Grund folgen tausend Ereignisse, alles überschneidet, widerspricht und schließt sich aus und ein), müssen doch auch Generalisierungen möglich bleiben.
Viele Menschen glauben zu sehr an den Staat. Sie verstehen nicht oder wollen nicht verstehen, dass der Staat kaum mehr sein kann als sie selbst. Wer den von ihm geschätzten oder gewählten Staat als alternativlos sieht, missachtet seine Mitmenschen. Wer den Staat, in dem er lebt, ablehnt, lehnt sich selber ab. Er müsste den Staat umstürzen oder gehen. Die DDR und Eritrea sind dafür schöne Beispiele. Die Divergenz des Staates mit seinen Bürgern kann man dank eines der besten Geschichtsbücher der letzten fünfzig Jahre*** bis ins letzte Detail und bis ins letzte Dorf studieren. Selbst gutgemeinte Wissenschaft führte zu Rassismus, wenn sie die Prämissen (Traditionen) von gestern als Maßstab anlegt, und selbst der bestmeinende Despot (Baudouin) wird in seiner Imitation (Mobutu) nicht nur zur Farce, sondern zum Monster. Mobutu hatte übrigens Ceausescu als Vorbild, der wiederum den Personenkult von Kim Il Sung imitierte.
Der Staat, als Staatsapparat, als Exekutive, ist ein Ordnungsinstrument, letztlich ein Attribut der Gemeinschaft. Durch seine Macht (Fiskus, Polizei) sehen wir ihn aber als Akteur. Der eigentliche Akteur ist das Parlament im Auftrag seiner Wähler. Da wir aber den gesamten Parlamentarismus nur medial konsumieren, oft sogar ignorieren, erscheint er uns als irrelevant.
Menschen in Ländern mit vielen oder gravierenden Problemen sehen die Lösungen deshalb im starken Staat, im charismatischen Führer. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich aber, dass Charisma nur im engen Raum-Zeit-Rahmen wirkt. Hitler erscheint uns heute als Parodie Chaplins ohne happy end. Trump und Berlusconi zeigten sich als Politclowns. Clowns, im schlechten Sinne, gibt es auch bei uns: Gysi, Wagenknecht, Höcke, sie brillieren mit einer Rhetorik, die einen kleinen Kreis von Menschen magisch anzieht, die sogar danach süchtig werden. Dadurch sind sie in den omnipräsenten Medien omnipräsent und erscheinen diesem engen Kreis von Menschen als die eigentlichen Macher oder Führer. Immer steht unter YouTube-Videos mit Wagenknecht: Wagenknecht muss Kanzlerin werden. Aber auf demokratischem Weg kann Wagenknecht zum Glück für uns alle nie Kanzlerin werden. Das ist ein Problem der Demokratie, das nur durch Bildung zu lösen ist. Wenn wir die 100 Milliarden Euro für die Rüstung akzeptieren, müssen wir zugleich 100 Milliarden für Bildung fordern. Nur damit können wir erreichen, dass ein Argument erkannt oder gefordert wird.
Die Allgegenwart von Medien und medialen Nachrichten vertieft die Verwechslung vom Ereignis und seinem Bild. Wir nehmen die Welt als Kommentar wahr. Der Unterschied zu früher ist, dass wir die Welt überhaupt wahrnehmen können, was früher in einem pommerschen oder anderswoigen Dorf schier unmöglich war. Es ist also ein Fortschritt, der natürlicherweise ein neues Problem hervorgebracht hat. Wie dem Alkoholiker muss man dem modernen Menschen die Flasche entziehen. Es ist nicht nur so, dass es viele, zu viele Nachrichten gibt. Die Nachrichtenmacher stehen vielmehr in einem ständigen Zwang, etwas melden oder kommentieren zu müssen. Selten gibt es gute Nachrichten. Nie sagt ein Nachrichtensprecher: heute ist nichts relevantes passiert. Und das würde auch nicht stimmen. Aber nicht alles, was passiert, wissen wir oder ist für alle relevant oder auch nur interessant.
Das ist alles schon tausendmal beschrieben worden, und trotzdem schaffen wir es nicht, unseren Fernseher oder das Handy auszuschalten. Wir müssen lernen, damit zu leben. Es ist nicht schlecht, informiert zu sein, aber zu viel Informationen führen zu einer neuen Formiertheit, wenn nicht sogar Uniformiertheit, die dann ganz schnell in Uninformiertheit zurückschlagen kann. Die rechte Kritik an den von ihren Protagonisten mainstream genannten Medien hat die eigenartige Lösung in noch kritikwürdigeren, nun auch noch unprofessionellen, absolut tendenziösen Medien, ganz ohne Korrespondenten und Kompetenzen. Auch Linksaußen folgt man lieber der vorgegebenen Ideologie, gestern zum Beispiel wurde ein sozial verträglicher Klimawandel gefordert. Dabei geht es nicht um die Lösung des Problems, sondern um die Erhaltung der Wählerschaft. Das ist natürlich bei jeder Partei so, aber die anderen sehen sich nicht als Alternativen zueinander, sondern als Komplementäre in zukünftigen Koalitionen.
Fernsehen und Internet verleiten uns auch dazu zu glauben, dass wir nicht nur alles wissen, sondern alles besser wissen.
Der Jäger und seine Sammlerin brauchten keine Nachrichten. Sie hatten nur 45 Jahre zu leben und mussten sich täglich um das Essen und die Kinder kümmern. Das bisschen Freizeit ging dafür drauf, die Götter günstig zu stimmen. Die Dorfbewohner im alten Pommern hatten einen streng reglementierten Tag, eine durchgestylte Woche und ein sich immer wiederholendes Jahr. Nur Schicksalsschläge und Kriege störten die Monotonie. Die Kartoffel, die Dampfmaschine, der Brühwürfel, die Eisenbahn, das Fahrrad, das Automobil, das Telefon, die Schallplatte, schließlich Radio, Fernsehen und Computer brachen die festen Rollen und rigiden Regeln auf. Jetzt haben wir Wohlstand, Bildung, Freiheit, Demokratie, Säkularisierung, Globalisierung und langes Leben und bejammern den Verlust von Heimat, irgendein Dorf mit Latrine.
*Ministerium für Staatssicherheit, DDR
**Kiew = russische Transkription
***David van Reybrouck, Kongo, 2010
