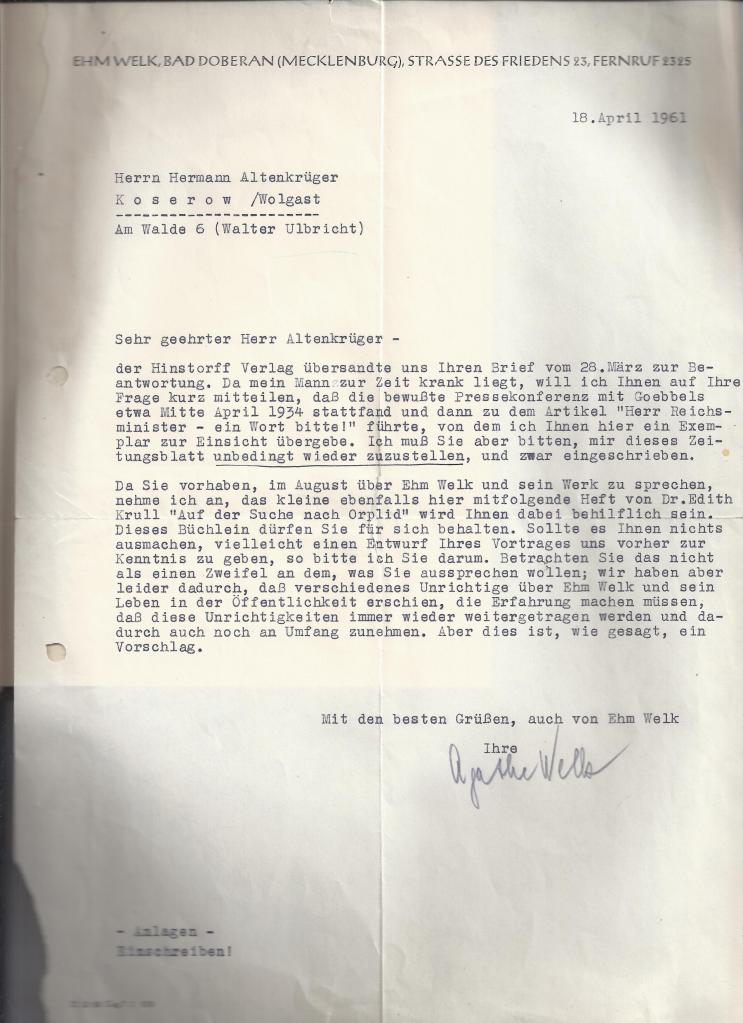Geschichte eines Stolpersteins
1
Mein Vater hatte die größte Gerberei weit und breit, bis Pommern hinauf und bis in den Barnim hinunter. Er war durch seine Gerberei und seinen Fleiß wohlhabend geworden, lief aber jahraus, jahrein mit seinen Arbeitssachen, die einen unangenehmen Geruch verströmten, durch die Stadt, was aber nicht allzu häufig vorkam. Wenn er etwas auf dem Bürgermeisteramt zu erledigen hatte oder kleine Besorgungen anstanden, schickte er seinen Prokuristen, seine Frau, also meine Mutter, oder später, seit ich zusammenhängend sprechen konnte, auch mich. Er war reich, aber er hatte die etwas eigenartigen Vorstellungen, dass sein Reichtum seinen Ursprung in der geografischen Lage seines Unternehmens hätte und dessen Fortbestand vom Schicksal durch mein Erscheinen vorbestimmt sei. Er hatte noch mehrere Kinder, aber mein Bruder Hugo fiel tatsächlich schon 1915 noch fast zu Beginn des Krieges. Mein Bruder Kurt interessierte sich nicht für Geschäfte und Gewerbe, nur für die alten Schriften. Er war der einzige Fromme von uns, aber das hat ihm dann letztendlich auch nicht geholfen. Meine Schwester Margarethe war wenig selbstständig, sie wollte eigentlich nur heiraten und las gerne Zeitschriften, in denen der noch ledige, aber furchtbar reiche Großherzog im benachbarten Strelitz abgebildet war. Wenn man bedenkt, dass es in der Zeit vor dem Weltkrieg schon emanzipierte Frauenzimmer gab, auch in unseren Kreisen, dann war unser Gretchen schwach und gestrig. Aber wir hatten sie trotzdem sehr lieb, jedoch hat sie dann keinen guten Mann gefunden und blieb erst dem Geschäft unseres Vaters, dann meinem Geschäft und mir zeitlebens verbunden. Die Hoffnungen meines Vaters richteten sich also auf mich, auch weil ich ohnehin der älteste war.
Unsere Gerberei lag außerhalb der eigentlichen Stadt, aber natürlich in Sichtweite. Die Ucker teilt sich hier in zwei Arme, von denen der eine, kanalisierte, schneller fließt, weshalb er DIE SCHNELLE heißt. Die Schnelle begrenzte unseren Betrieb auf der Ostseite, westlich lag die Straße nach Neubrandenburg, nördlich waren Feuchtwiesen bis hin zur Zuckerfabrik, dahinter das Gaswerk, an der Straße schlossen sich kleine Handwerksbetriebe und einzelne Häuser an. Unser Haus lag mit dem Giebel zur Straße, trotzdem konnten wir aus dem Wohnzimmerfenster die riesige Marienkirche sehen, die sich in meinem Gedächtnis für immer eingebrannt hat, wo ich auch war und ungeachtet dessen, wofür sie – außer ihrer architektonischen Majestät – noch steht. In der Gerberei verbraucht man sehr viel Wasser, und unser Wasser kam aus dem nicht weniger majestätischen Unteruckersee. Es floss dann nach Ueckermünde ab und ins Stettiner Haff. Später, als ich schon kein Kind mehr war und unternehmungslustig und wissbegierig, fuhr ich mit dem Fahrrad, teils auf der Reichsstraße, teils auf wunderschönen Feldwegen an der Ucker entlang, ab Nieden und Nechlin heißt sie dann Uecker, um zu erforschen, wie lange man die Farb- und Gerbreste unserer Produktion sehen kann. Schon im großen Ueckertal bei Pasewald gab es keine Spuren mehr von uns. Die ganze Prozedur unserer Gerberei erschien mir widerwärtig. Die toten Felle, der Verwesungsgeruch, die Chemikalien, das verunreinigte Wasser des unschuldigen Flüsschens, das alles ekelte mich. Wenn mein Vater auf jemanden ärgerlich war, dann sagte er, dass er ihm das Fell über die Ohren ziehen wolle. Mir wurde dann speiübel, denn ich sah es täglich vor mir. Gleichwohl war mir der Reichtum meines Vaters angenehm und er machte mich auch angenehm vor meinen Mitschülern in der Knabenschule am Mitteltorturm. Es ist leicht möglich, dass ich an diesem Tag meiner ersten Fahrradtour beschloss, auf keinen Fall Gerber zu werden. Auch wenn ich mich nicht an den genauen Tag meines Beschlusses erinnern kann, bin ich doch sicher, dass es in jenem Jahr war, als ich dreizehn Jahre alt wurde und sich so vieles veränderte. Mein Körper zeigte mir, dass ich ein Mann würde, und der Blick auf den Kalender bewies, dass ich zu Großem bestimmt war. Denn es begann eine neue Zeit, ein neues Jahrhundert, ein Aufbruch, den ich ganz gewiss zu meinen Gunsten würde nutzen können.
Die Zeitungen damals waren voll von den Versprechungen für das neue und wieder einmal goldene Zeitalter, das nun begänne. Wir Jüngeren, besonders die Knaben und Jünglinge, waren angetan vom Siegeszug des Automobils, von dem der Kaiser, wiewohl er sieben Automobile besaß, sagte, dass es keine Zukunft hätte und er weiter an das Pferd glaube. Im Bahnhofsviertel gab es den Rossschlächter Blaumann, übrigens seit 1846, also länger als unser Geschäft, der hatte jetzt schon Hochkonjunktur. Die Gutsbesitzer der umliegenden Dörfer kauften Lokomobile oder die ersten Traktor-Zugmaschinen von Lanz aus Mannheim. Die reichen Leute schafften ihre Kutschen ab und kauften sich Automobile. Die Kutscher wurden Wagenlenker. Die Pferde wurden Salami. Aber hier bei uns stimmte die Welt noch, die Weiden waren voll, die Bierkutscher brüllten. Aber wir sahen uns jedes Automobil aufmerksam an.
Die Älteren dagegen bevorzugten als Objekt ihrer Bewunderung das Telephon. Jetzt könne man, sagten sie, gleichzeitig in der Heimatstadt und in der Reichhauptstadt sein. Mein Vater hatte einen der ersten Telephonapparate in Rantzlau. In der Schule und in den politischen Versammlungen, soweit man davon hörte, war viel von der deutschen Sache die Rede. Aber mein Vater, der alles praktisch und unter dem Vorzeichen seines blühenden Gewerbes sah, erklärte alle Tümer, das Deutschtum wie das Judentum, das Empire wie den american way of life und auch das hinterwäldlerische Russentum zu Irrtümern. Deutschtum, sagte er, ist nichts als ein Irrtum. Es kommt nicht auf die Herkunft an, sondern auf die Zukunft. Jeder will seine Waren verkaufen, deshalb erklärt er den andern für falsch, unmodern, erblich belastet, qualitativ schlecht. Tum heißt immer Neid, und aus Neid wird schnell Gier. Das steht alles schon in den alten Schriften. Lass es dir von deinem Bruder Kurt erklären. Selbstverständlich, sagte er weiter, sind meine Leder besser als die vom Gerber Mamlock aus Preußisch Stargard. Wenn ich das nicht glaubte, könnte ich meinen Laden zumachen, und du mein Junge, würdest nichts als heiße Luft und kaltes Wasser aus der Schnelle erben. Er lachte laut, voller Selbstbewusstsein und Würde. Und ich lachte aus vollem Herzen und gerne mit, denn ich liebte meinen Vater. ‚Ist der Mamlock aus der Steinstraße dieser Konkurrent?‘ fragte ich. ‚Nein,‘ sagte mein Vater, ‚sein Vater. Der Mamlock aus der Steinstraße ist leider ein Beispiel, das man nicht nachahmen sollte. Er kann nur handeln. Aber statt nur mit dem zu handeln, was auf seinem Firmenschild steht, handelt er im Hinterzimmer seines Ladens mit allerlei Schmuddelei. Das ist kein Verbrechen, aber auch keine saubere Sache. Wir bleiben bei unserm Handwerk, das nach außen schmutzig sein mag, das wir aber reinen Herzens betreiben können.‘ So versuchte mein Vater mir die hehren Grundsätze, ja die Ethik des Handwerks beizubringen. Und das hatte auch durchaus Erfolg, ich wurde später ein gewissenhafter Kaufmann, rechnerisch und moralisch. Aber, was mein Vater noch nicht einmal ahnen konnte, und er ist zum Glück auch rechtzeitig gestorben, um mit sich selber im Reinen zu bleiben, was er nicht wissen konnte, war, dass dieser eine Grundsatz nicht ausreichen würde, um unser Leben zu Sinn und Erfolg zu bringen.
Er ahnte ebenfalls noch nicht, dass ich seinen vergifteten Laden nicht erben wollte, um nichts auf der Welt. Ich liebte meinen Vater, aber ich hasste sein schmutziges Gewerbe. Ich war dem Geld nicht abgeneigt, aber es durfte nicht stinken.
Und ich ahnte noch nicht, dass ich, gerade dreizehnjährig, einen Abscheu und Widerwillen gegen jede Vorbestimmung entwickelte. Nach Meinung der meisten Lehrer und Väter war der Weg des Menschen auf der einen Seite durch seine Herkunft bestimmt. Der Gerbersohn wird wieder Gerber, der Gutsbesitzersohn wird Gutsbesitzer oder General. Der Kameruner bleibt ein Sklave, wenngleich er jetzt die einklassige und erstklassige deutsche Dorfschule durchlaufen darf, bevor er schuften muss. Auf der anderen Seite mussten zur Herkunft auch Fleiß und Wohlanständigkeit hinzutreten.
Mein Bruder Kurt, der ununterbrochen las, las nicht etwa nur fromme Bücher, wie er uns glauben machen wollte. Er las auch Philosophen und Romane. Eines Tages lag eines dieser Bücher aufgeschlagen auf dem Tischchen neben seinem Bett. Ich las den Satz DENN DAS BESTE, WAS EINER IST, MUSS ER NOTHWENDIG FÜR SICH SELBST SEIN und hatte mein Lebensprogramm gefunden. Ich war noch so jung, schickte mich gerade an, aus den kurzen Hosen und Leibchen herauszuwachsen, und wusste schon, was ich wollte. Ich wollte Ich sein, nichts weiter. Hatte Gott selbst nicht gesagt: Ich bin Ich? Was bedurfte es weiter Zeugnis? Welches Schicksal auch kommen würde, ich müsste stets versuchen, es auf meine Weise zu umgehen oder auszuführen. Wo ich ein unsichtbares Gängelband entdeckte, müsste ich es zerschneiden, zerstückeln und zernichten. Plötzlich schien mir mein vor mir liegendes Leben in einem wunderbaren Licht, in fast goldenem Glanz: wohin mich einer schicken würde, ich würde das Ziel verfehlen, was ein Jemand von mir wollen würde, ich wollte es verweigern und stattdessen meinen Weg gehen, wie steinigt jener Pfad, der meiner wäre, auch sein würde. Der trockene Ernst der meisten Leute rührt daher, dass sie an den Drahtfäden des Schicksals wie Puppen anhängen. Dagegen würde ich, wenn mir gelänge, was ich an diesem Tag angesichts des Satzes aus dem Buche des weisen Mannes mit dem schlohweißen Haar beschloss, wie der einzige Mensch in diesem Marionettentheater handeln. Die zumeist schläfrigen Zuschauer würden den Unterschied gar nicht oder erst zu spät bemerken. Welche Pläne das Schicksal mit mir auch haben würde, ich würde sie kühn durchkreuzen.
Meine Lehrer waren die ersten, an denen ich mein neues Ideal versuchte. Sie schwangen den Rohrstock und schlugen ins Leere. Zumal ich auch gute Leistungen in allen Fächern vorweisen konnte, waren ihre Vorhaltungen und Ermahnungen, die sie auch meinem Vater zukommen ließen, ganz unnütz und in den Sand geschrieben. Überhaupt ging unsere Schule, wiewohl sie architektonisch hübsch anzusehen war, ganz anders als die roten neogotischen Klinkerbauten, welche die Stadt dominierten und mit der tatsächlichen Gotik auf das beste harmonierten, ganz anders, moderner, menschennäher war unser Schulbau, und die ihr zugrunde liegende Pädagogik am Menschen, jedenfalls an mir, vorbei. Sie zielte auf einen Menschen, der sich bereitwillig seinem Schicksal ergeben soll, immer auf dem vorgeschriebenen Pfad wandeln würde. Ein Mensch sollte das sein, dem das Vaterland mehr wert war als er selbst, die endliche Regel mehr galt als das lebenslange und unendliche Lernen. Lernen war ihnen kein Forschen, sondern ein Kopieren. Aber sie bemerkten nicht, dass es keine Kopien waren, die sie erzeugten, noch nicht einmal Kopien, sondern Karikaturen. Es gab keine Jugend, nur Greise, junge und alte, die bärtig und übellaunig, die Hände auf dem Rücken, blind durch die Stadt und ihr Leben wandelten. Am krassesten war das alles im Militär zu sehen, und davon war unsere kleine Stadt voll, voller als von Gotik. Allein die riesige Kaserne des 64. Infantrieregiments thronte beinahe bedrohlich über der Stadt. Während die Marienkirche in der Betrachtung Staunen erzeugte, brachte dieser Bau nur Schrecken hervor. Schon als Knabe dachte ich: ihr wahrer Gott war der Krieg, den beteten sie inständig an und hassten ihre Nachbarn. Am meisten meschugge waren die Soldaten, wenn sie betrunken waren, kurz vor dem Zapfenstreich. Dann zeigten sie ihr wahres Gesicht: es war zur Null geschrumpft, abwesend, löchrig, öde und blöde.
Mein Vater wollte, dass ich bald, noch vor dem Einjährig-Freiwilligen Jahr von der Schule abginge, um bei ihm im Geschäft als sein Lehrling einzutreten. Ich dagegen wollte das Abitur ablegen, um einen guten Start ins Leben zu haben, gleichgültig, ob ich studieren könnte oder nicht. Zum Fache hatte ich mir etwas Praktisches und Lebensnahes ausgewählt, nämlich die Ingenieurwissenschaften, die ich an der technischen Hochschule in Charlottenburg mir aneignen wollte. Mein Vater war empört und sagte, es gäbe auf der Welt nichts Ehrenvolleres als einen Handwerksberuf in deutschen Landen auszuüben. Sein ganzes Leben, sagte er, habe er auf diesen einen Moment hingelebt, mir, seinem ältesten und liebsten Sohn, das Erbe, den Betrieb, die Ehre und nicht zuletzt das angehäufte Vermögen zur weiteren Nutzung und Vermehrung zu übergeben. Er würde verstehen, sagte er, wenn ich nach altem Handwerksbrauch zunächst ein oder zwei Jahre durch Europa wandern wollte. Er würde auch verstehen, sagte er, wenn ich ganz ohne erkennbaren Sinn eine längere Reise unternehmen wollte, um mir die Welt anzueignen, bevor ich meine Pflicht und Schuldigkeit hier in unserem ehrwürdigen Städtchen antreten wollte. Das alles würde er verstehen. Aber was nicht ginge, wäre die Desertation, das Verschwinden aus dem Tribut vor der Leistung nicht nur meines Vaters, sondern der Väter überhaupt.
Zum ersten Mal, abgesehen von den Geplänkeln mit den müden Lehrern, musste sich mein Wille und meine Vorstellung bewähren. Ich sagte etwa dies: Vater, ehrwürdig ist an diesem toten Städtchen nur die gotische Maria. Alles andere ist Schall und Rauch. Mein Bruder Kurt kicherte in sich hinein, der Rest der Familie war entsetzt darüber, dass es ein Sohn wagte, nicht nur seinem Vater zu widersprechen, sondern den Widerspruch auch noch mit der Schmähung der Väter, der alten Schriften und jedweder Heimat überhaupt zu begründen.
Ich muss nun eingestehen, dass es mir weder im ersten noch im zweiten Anlauf gelang, mich tatsächlich zu lösen. Mir fehlten die Kraft und die Courage, mein Bündel zu schnüren und ohne Segen und Geld wegzugehen. Das Nomadentum war gerade einer der Vorwürfe, die unseren Kreisen immer wieder von vaterländischer Seite gemacht wurden. Der Deutsche wäre heimattreu, hieß es, unsereiner dagegen zu ewiger Wanderschaft verdammt. Zwar schmetterten die Sozialisten WACHT AUF VERDAMMTE DIESER ERDE, aber in mir gefror das Blut allein bei dem Gedanken, meinen Vater zu verraten. Ich war kein Sozialist und wollte auch keiner werden, obwohl aus unseren Kreisen viele dort mitmachten. Zudem war ich schon wach, wie ich glaubte, denn ich hatte damals an der Ucker, wo sie schon Uecker heißt, geschworen, dem Schicksal, was es auch brächte, zu widerstehen.
Statt Sozialist zu werden, kaufte ich mir über die nun folgenden Jahre die Hefte von Rustins Selbstlernmethode ‚Der deutsche Kaufmann und sein Rechnungswesen‘. Was mir im ersten Anlauf trockene Theorie zu sein schien und meinem Widerwillen dennoch trotzte, erwies sich im Laufe der Jahre als treuer Gefährte wachsenden Wissens. Immer stellte ich mir ein Geschäft vor, das eine weniger widerwärtige Produktion innehätte, vielmehr vielleicht gar keine Produktion, sondern eine Distribution: ein schönes Ladengeschäft in einer freundlichen Stadt. Dazu imaginierte ich eine bildschöne und liebreiche Frau, die treu und zärtlich an meiner Seite stünde, und eine kleine Schar hell aufgeweckter Kinder, denen ich ihre spätere Bestimmung nie und nimmer vorschreiben wollte. Alle Knaben wollen Polarforscher oder wenigstens Lokomotivführer werden, aber werden dann Handwerker wie ihr Vater, ziehen Frau und Kinder dem Abenteuer vor. Die Mädchen wurden damals bekanntlich nicht gefragt, hatten sich noch mehr zu fügen als die Knaben. Aber meinem Leben blieb es vorbehalten, den weiblichen Anteil schätzen zu lernen. Denn ich hatte eine sehr tüchtige und treue Schwester und später eine ebenso bewundernswerte, noch dazu gleichnamige Frau. Die Kinderschar blieb bis auf unsere geliebte Inge aus.
Während der Konflikt über die Jahre hinweg schwelte, erlernte ich neben dem Rechnungswesen aus den Selbstlernbriefen, die ich mir von meinem kärglichen Taschengeld absparte, das ungeliebte und giftige Handwerk. Mit meinem Vater sprach ich nur das Nötigste und kränkte ihn ohne notwendige Ursache. Hätte ich unser späteres Schicksal auch nur geahnt, so hätte ich in den Boden versinken müssen vor Scham. Aber ich glaubte damals, dass die Welt die Verwirklichung unserer Vorstellungen wäre, ungetrübt, frei von Zwecken. Dass der Mensch auch des Menschen Wolf werden könnte, wurde mir erst viel später in Triest klar. In Triest habe ich oft gedacht, dass die vielen Drachen, die man in den Märchen getötet hatte, Menschen waren, die zum Ungeheuer, zum Ungeziefer geworden waren.
Das Traurige ist, dass unser Streit durch ein schreckliches Ereignis beendet wurde, das gleichzeitig das Ende der bis dahin bekannten und geliebten Welt bedeutete: der Weltkrieg brach aus, indem Serbien frech sein Haupt erhob. Aber statt milde zu lächeln, befahlen unsere Kaiser uns alle zu den Waffen. Und alle gingen freudig hin – und marschierten geradewegs in die Ewigkeit. Ich ging widerwillig hin, konnte aber aus zwei Gründen meinen Plan, mich fremdem Willen zu widersetzen, nicht erfüllen. Der erste Grund war die Übermächtigkeit des Ereignisses, dem ich mich sozusagen als pazifistisches Elementarteilchen gegenübersah. Der zweite Grund war, dass ich die Bedrohung falsch herum sah: nicht das kleine Serbien bedrohte uns, sondern wir wurden von uns selbst bedroht: von unserer Habgier und Herrschsucht, von unserem Verlust des weisen Lächelns, vom Wahn der Stärke und der Impotenz der Macht. Die Generäle schrien ihre Befehle in den Wind, und wir verloren Meter um Meter. Das Jahrhundert war schon tot, noch ehe es richtig begonnen hatte. Die schönen Hoffnungen alle: nun lagen sie in der Erde vor Verdun und Langemarck. Wir hatten gerade so viel Land erobert, dass wir unsere toten Kameraden beerdigen konnten.
Mein Bruder Hugo fiel schon 1915 in Flandern. Auch er war Vaters Hoffnung gewesen. Neue Wörter kamen auf, die schreckliche Dinge benannten: Gaskrieg, Tank, verschüttet, verstümmelt, zum Krüppel geschossen, Stellungskrieg, Kriegsblinder. 1916 wurde der erste gut ausgebildete Blindenhund einem Kriegsblinden übergeben, obwohl es schon seit Herculaneum bekannt war, dass Hund und Mensch sich gut und gegenseitig helfen können. Je länger der Krieg dauerte, desto weniger gab es zu essen, von Munition und Waffen ganz zu schweigen. Daran konnte auch Rathenau nichts ändern, der jetzt der Minister für Kriegswirtschaft geworden war. Rathenaus Familie stammte genau wie ich aus unserem guten alten Städtchen Rantzlau. Ich selbst wurde verschüttet und konnte von da an nicht mehr gut hören. Hitler war blind im Behelfslazarett in Pasewald, aber ich konnte ihn nicht hören. Hätte ich ihn verstanden, wäre uns manches erspart geblieben. Niemand aus unseren Kreisen verstand ihn. Es war unvorstellbar, was er sagte, selbst wenn er brüllte und kreischte. Es war ganz und gar unverständlich. Ich kannte keinen, der ihn verstand, aber Millionen trotteten hinter ihm her, marschierten im Gleichschritt in den Tod.
Ein Gutes hatte aber der Krieg: ich zog endlich, nämlich als er zu Ende war, von zuhause weg und ging nach Hamburg. Hamburg hatte ich nicht nur ausgewählt, weil alle, die ich kannte, nach Berlin gingen. Hamburg hieß eine freie Stadt und war es auch. In Hamburg sollte mir ein großes Glück blühen, das sich aber dann in mein größtes Unglück verkehrte, und nicht nur meines.
2
9. November 1918
Sehr geehrter Herr Jacobsohn,
wir haben Ihren lieben Brief dankend erhalten und erwidern freundlichst Ihre herzlichen Grüße. Es erscheint uns als ein großes Glück und als ein Wink des Schicksals, dass gerade ein Kaufmann wie Sie, noch dazu aus einer gutsituierten Familie, sich um die Wohnung im Erdgeschoss bewirbt. Der Krieg hat ja manches durcheinander gebracht, aber die guten Familien behalten doch die Oberhand. So wie Sie aus einer alten Handwerksfamilie stammen, sind wir seit Generationen Kaufleute. Auch das Haus befindet sich seit einer Generation in unserem Besitz. Wir sind sehr stolz darauf, aber wir teilen es auch gerne mit solch lieben Menschen, wie Sie einer zu sein scheinen. Seien Sie uns also herzlich als Mieter und Mitbewohner, vielleicht sogar als Nachbar und Freund willkommen. Über alles Geschäftliche, was ja leider immer unvermeidlich ist, werden wir uns schnell einig, machen Sie sich da bitte keine Sorgen über. Seien Sie lieb gegrüßt bis zu unserem Wiedersehn.
Herzlichst Ihre Grete Ahlers.
Februar 1939
Mein lieber Jacob,
schon das Wort Fuhlsbüttel tut tief im Herzen weh, wenn man weiß, dass Du nur dort bist, weil Du uns schützen wolltest. Beinahe genauso schlimm ist es, dass die Nachbarn, die von uns wissen, auf mich zukommen und sagen: ach, liebe Frau Ahlers, das war doch ein so netter Mann, Ihr Mann, unvorstellbar, dass er Ihnen das antun konnte. Das ist fast genauso schlimm, wie Dich dort zu wissen, wo seit vielen Jahren die Schwerverbrecher sitzen. Ach, in Santa Fu ist Ihr Mann?, fragen manche, und ich muss dann – wahrheitsgemäß bitter – sagen, das ist nicht mein Mann. Die tapfere Inge dagegen sagt weiter, dass Du ihr Vater bist, denn vom Vater kann man sich nicht scheiden lassen. Aber sie will sich auch gar nicht scheiden lassen. Wenn sie vielleicht auch nicht das ganze Drama versteht, so liebt sie Dich doch weiter als ihren Vater, und ich liebe Dich weiter als meinen Mann, denn vor Gott sind wir weiter Mann und Frau. Auch Deine Schwester Grete, die so fleißig und tüchtig im Geschäft ist, lässt Dich grüßen, frägt ständig nach Dir, und ist Dir dankbar und unvermindert zugetan. Inge hat nun ihre Lehre als Verkäuferin begonnen und sie macht mir große Freude und erhält nur gute Zeugnisse. Das Geschäft läuft gut, wenn Du uns auch sehr fehlst mit Deiner Weitsicht und Deinem Instinkt für Mode und Frauen und Farben und Geld. Ach, Jacob, es ist alles so traurig, aber ich will Dir das Herz nicht noch unnötig schwer machen, denn am schwersten von uns allen hast Du es da in Deinem dunklen Kasten. Deswegen kann ich Dir nur sagen, wie unendlich dankbar wir Dir sind, wie unendlich liebevoll wir in jeder Stunde des Tages und vielen Stunden der Nacht an Dich denken und Dich in unser Gebet einschließen. Halte durch, sei so tapfer, wie Du bisher warst. Denn einmal kommen bessere Zeiten, wird wieder Licht sein, wo sich jetzt dunkle Wolken mit ihren mächtigen Schatten versammeln und sich uns als Steine in den Weg stellen. Eines Tages werden die zwei Jahre um sein. Weißt du noch, wie schnell das halbe Jahr, seit Du bei uns eingezogen warst, vergangen ist und wir so glücklich geheiratet haben? Und dann kam die Inge aber gar nicht, wie wir gleichzeitig befürchtet und erhofft hatten. Aber wir haben es bis heute nicht bereut, nicht wahr? Was da in diesem halben Jahr entstanden ist, wenn es auch noch nicht die Inge, sondern nur die Liebe war, hat ein ganzes Leben – bis jetzt – gehalten und wird, das versichere ich Dir vor Gott, auch noch den Rest des Lebens halten. Halte die Ohren steif, es grüßt Dich Deine „geschiedene“ Frau Else.
31. Dezember 1940
Mein lieber Jacob, mein lieber, lieber Mann,
endlich und gerade zu Weihnachten bist Du frei. Und Du hast recht, es ist egal, wo man frei ist. Freisein ist wichtiger als Hiersein. Das ganze Dasein ist ein Suchen nach Freiheit. Man sieht es bei der Stubenfliege am Fenster, wie sie verzweifelt den Weg sucht und ihn nicht finden kann. Sie versteht die Scheibe nicht, so wie wir das Leben nicht verstehen. Ich weiß nicht, ob es einen Gott gibt, aber irgendjemand scheint die Hand über uns zu halten, so dass Du nun endlich vor dem Fluch fliehen kannst. Glaub mir, es gibt genug Deutsche, die den Fluch nicht teilen, die wissen, dass es, wenn es einen Gott gibt, nur einen Gott gibt, der für alle Menschen da ist. Ich weiß, dass es sie nicht gibt, aber das Böse in mir will es immer wieder fragen, ob es die Frau gibt, mit der Du Rassenschande betrieben haben willst? Es gibt sie, weil Du uns mit dieser Lüge gerettet hast, die Inge aus allem herausgehalten hast. Ich habe an Eides statt ausgesagt, dass die Inge christlich erzogen wurde. Noch lieber hätten sie gehört, dass die Inge nationalsozialistisch erzogen wurde. Aber das erschien mir dann doch zu dreist. Du hast es besser gemacht. Der Rechtsanwalt hat mir Einblick in die Gerichtsakten gegeben. Du hast so schön gelogen, dass die Welt in ihrem Sinne wieder stimmt: wie Du Rassenschande mit dieser Frau betrieben hast, die es gar nicht gibt, wie Du Deine über alles geliebte Tochter Inge hasst, weil sie von mir, Deiner „geschiedenen“ Frau „christlich“ erzogen wurde. Wenn ich so weiterschreibe, wissen wir zum Schluss vor lauter Gänsefüßchen nicht mehr, was Wahrheit ist und was Lüge. Und so ist auch diese ganze Zeit: wenn man die Wahrheit sagen will, muss man lügen, und wenn man lügt, sagt man aus Versehen die Wahrheit und kommt ins KL. Der Kamerad von Dir brachte uns deinen Brief, so dass wir gleich wussten, dass alles gut gegangen ist. Ich habe ihm Schnittchen gemacht und Kaffee gekocht, und er sagte uns, wie lange er das hat vermissen müssen. Aber er hat nicht gesagt, warum er im Zuchthaus war. Früher, als Mädel, habe ich immer gedacht, im Zuchthaus sitzen nur Schwer-verbrecher, die ihre Mutter ermordet oder eine Bank ausgeraubt und den Bankdirektor erschlagen haben, aber nun sitzen im Zuchthaus auch solche Menschen wie Du und Dein Kamerad, die anderen geholfen haben, die sich wie die Märtyrer im Mittelalter geopfert haben, nicht für eine große Sache, wie sie immer sagen, sondern für einen geliebten Menschen. Du hast ihnen mit Deiner Aktion und mit Deinem Opfer den Wind aus den Segeln genommen, hast sie mit ihren eigenen Waffen geschlagen. Und, mein lieber Jacob, ist das nicht das Größte, was man tun kann, für andere Menschen da sein und auch selber weiterleben?
Um das Geschäft musst Du Dir keine Sorgen machen. Deine Schwester und ich führen es, so gut wir können, ganz in Deinem Sinne fort. Letzten Sommer haben wir sogar eine Hilfskraft einstellen müssen, denn es gibt immer Reisende, die sich hierher verlaufen, wie wir immer scherzhaft sagen. Im Winter dagegen kommt nur die Stammkundschaft. Aber unsere Hilfskraft freut sich über jede Mark, die sie dazu verdienen kann und grollt uns nicht, wenn wir sie nicht brauchen. Denk Dir nur, ihr Mann musste in den Krieg ziehen, obwohl er schon fünfundvierzig Jahre, aber ein ausgebildeter Reservist ist. So hat jeder sein Päckchen zu tragen. Dass Du aber auch im Obdachlosenasyl verbringen musstest, wenn es auch nur wenige Tage waren! Für das Neue Jahr wünschen wir, Deine Schwester, Deine Tochter und natürlich ich, Deine Frau ohne Anführungszeichen, alles Gute und Glück auf den Weg, wohin er Dich auch führen mag.
Deine Else, die Dich liebt und küsst und herzt.
12. Januar 1942
Mein lieber Jacob,
ich hoffe, dass Du unsere Geburtstagsgrüße rechtzeitig erhalten hast. Wir können uns hier nicht vorstellen, wie Dich unsere Briefe erreichen und auf welchen verschlungenen Wegen Deine Antworten treulich zu uns gelangen. Krieg ist Krieg und Post ist Post, sagte mein Großvater immer, der Briefträger und Feldwebel war. Ich musste erst im Brockhaus Lexikon nachsehen, was überhaupt ein Partisan ist und wo Triest liegt. Du bist in der Welt und wir sitzen hier immer noch im Hinterstübchen von unserem Laden. Ich getraue mich kaum, Dir meinen Dank für das, was Du für uns und für Deutschland tust, auszudrücken, aus Angst, der Brief könnte mitgelesen werden. Man hört so viel Schlechtes und Böses in dieser schlechten und bösen Zeit. Warum müssen wir Paris besitzen und was suchen wir in Russland? Wir als Ladenbesitzer wissen doch am besten, dass man anderen Menschen nicht einfach etwas wegnehmen kann. Der Führer sagt immer, dass wir durch unsere höhere Rasse berechtigt sind, aber ich glaube, dass eine höhere Rasse ja gerade uns zwingt, Recht und Ordnung einzuhalten. Außerdem: wer von uns beiden soll und will denn eine höhere Rasse sein? Du bist doch nicht weniger deutsch als ich, und ich bin nicht mehr deutsch wie Du, und was soll denn deutsch anderes sein als die Sprache? Und den Glauben haben wir beide nicht, Du nicht den Deinen und ich nicht den Meinen. Und bei unserer Inge haben wir den Glauben doch nur vorgeschoben, weil sie es so hören wollten, da müssen plötzlich die selbst die Nationalsozialisten Christen sein. Denk Dir nur, dass der Pfarrer in unserer Gustav-Adolf-Kirche im Talar seinen Arm zum Hitlergruß erhebt – das ist Gotteslästerung und Rassenschande! Ach, jetzt denke ich schon selber so wie die neuen Herren, die alles verderben.
Soweit ich unser Lexikon verstehe, das Partisanen mit Parteigängern zunächst übersetzt, befassen sich diese, also auch Du, damit, dem Feinde, also uns, ohne steten Zusammenhang zum dortigen Heer, zu schaden, wo sie nur können. Das tust du recht, denn auch in Jugoslawien haben wir nichts zu suchen. Das ist nicht nur meine feste Überzeugung, sondern scheinbar auch Deine. So langsam verstehe ich Deinen Lebensplan. Du hast Dich eines Verbrechens bezichtigt, das Du nicht begingst, um die wahren Verbrecher, die Gestapo, von dem, was sie als Verbrechen ansehen, abzulenken. Um unsere Inge zu schützen, hast du Dich zum Verbrecher erklärt, und folgerichtig haben sie Dich dann auch verfolgt. Aber wie hast Du es geschafft, dass sie Dich nach Deiner verbüßten Strafe auswiesen statt ins KL einwiesen? Zum Glück hattest Du in Deiner Gemeinde – so wie ich in meiner Gemeinde – ohne recht eigentlich Mitglied zu sein, Deinen Mitgliedsbeitrag bezahlt, so dass sie Dich, nachdem Du aus dem Zuchthaus entlassen warst, in einer Obdachlosenunterkunft unterbrachten und Dir sodann halfen, unser Heimatland zu verlassen. Aber warum schickten sie Dich nach Jugoslawien, von dem wir früher kaum etwas wussten, als dass sie dort ihren König umgebracht haben? Jedenfalls habe ich das damals in der Zeitung gelesen.
Aber wissen wir denn überhaupt etwas über das Warum? Wir Menschen tun gerne so, als wenn wir das, was wir tun, zuvor gedacht und geplant hätten. Aber kannten wir uns, als Du damals bei uns eine Wohnung suchtest? Konnten wir ahnen, dass wir innerhalb eines halben Jahres uns verlieben würden, zusammenziehen, verloben, verheiraten würden? Das konnten wir alles nicht wissen. Und als dann Deine Eltern nacheinander starben, war es da nicht Fügung statt Willen, dass Deine liebe Schwester, die noch dazu den gleichen Vornamen wie ich hat, so dass wir mich nach meinem zweiten Vornamen umbenannten, dass diese Deine Schwester eine so liebe und fähige Ergänzung unseres Lebens und Strebens sein würde? Und wieviel Freude machte uns unsere Inge. Hätte sie nicht auch böse, unartig, entartet gar werden können, den Nazis nachlaufen, einen Hitlerjugendführer lieben können, ihre Eltern denunzieren, das alles hätte sie auch machen und sein können. Gut, es gibt da die Erziehung. Aber gibt es nicht auch die Verführung? Man hört so viel Böses, dass man sich über das Gute, das uns bisher widerfuhr, nur freuen kann, freuen und von Herzen dankbar sein kann. Ob die Güte wohl obsiegen wird?
Es grüßt Dich von Herzen
Else
27. Juli 1943
Mein lieber Jacob,
noch im vorigen Jahr schrieb ich Dir, dass die Güte obsiegen wird, dass alles gut wird, dass wir uns wiedersehen. Widersehen können wir uns, aber es steht nichts mehr in unserer Straße. Vorgestern und gestern fielen hunderte Bomben von den feindlichen Flugzeugen. Aber sind es denn wirklich unsere Feinde? Gibt es denn Feinde? Oder werden nicht vielmehr mehr oder weniger zufällig Menschen und Völker zu Feinden erklärt und andere zu Freunden verklärt. Wer kennt sich da noch aus? Das Gute ist, dass Inge in der Berufsschule war, Grete war Einkaufen und im Schutzraum dort, und ich konnte hier im Nachbarhaus rechtzeitig im LSR verschwinden. Als wir nach zwei Stunden herausdurften, war die Straße weg. Alle Häuser waren mehr oder weniger kaputt. Es war schrecklich. Aber war es nicht auch schrecklich, was deutsche Soldaten den Menschen in allen unseren Nachbarländern angetan haben?
Ich war ganz verzweifelt, aber noch am Abend, wir saßen in einer Notunterkunft der NSV, fingen Grete und Inge an, Pläne für die Zukunft zu schmieden. ‚Wir müssen,‘ sagte Inge, ‚wenn der Vater zurückkehrt, das Geschäft und die Wohnung komplett wieder aufgebaut haben, und sogar vergrößert und verschönert muss es wieder auferstehen. Denn der Vater hat alles für uns getan, dass wir leben, so müssen auch wir für ihn alles tun, damit er gut leben kann.‘ Da staunst Du, wie erwachsen und verständig die Inge in den Jahren geworden bist, die Du nicht hier warst. Wir haben überlegt, wo Läden frei geworden sind, entweder, weil Juden enteignet worden waren, das nennt sich jetzt ‚arisieren‘, oder weil die Besitzer bei Bombenangriffen ums Leben gekommen sind. Bombenangriffe – das gab es ja im Weltkrieg nicht. So ist alles anders geworden. Inge schrieb eine Liste mit solch freigewordenen Läden und wir teilten auf, wer in den nächsten bombenfreien Tagen welche Straßen und Häuser begutachten sollte. So haben wir buchstäblich in der größten Katastrophe gleich wieder neu angefangen. Bürgermeister Krogmann hat angesichts der vielen tausend Toten gesagt: Wir müssen leben und kämpfen, damit unsere Toten leben. Aber wir drei Frauen haben noch am Abend beschlossen, dass wir leben und kämpfen müssen, damit die Lebenden weiterleben können.
Hast du auch genug zu essen? Hier ist ja alles knapp, aber es reicht, wir drei Frauen essen nicht so viel wie ein Mann. Wir müssen immer lachen, wenn wir an Deinen Appetit denken müssen, besonders an deine Erklärung. Jetzt, wo Du nicht mehr die giftigen Dämpfe aus der Gerberei Deines Vaters riechen musst, kannst Du all das essen, was Du früher aus Ekel aufsparen musstest. Aber wir freuen uns, wenn Du wieder hier bist, dass wir für Dich Essen kochen können. Auch die Inge kocht schon recht gut, und wenn sie bis dahin keinen Mann gefunden hat, wird sie auch für Dich kochen, so wie Grete und ich es gerne tun werden.
So Gott will, sage ich immer, wenn der Krieg vorbei sein wird und wenn Hamburg wieder aufgebaut ist. Von Rantzlau haben wir nichts gehört, außer, dass es nicht zerstört und zerbombt ist. Nach dem Krieg kannst Du hinfahren und die Stätten Deiner Kindheit und Jugend aufsuchen. Kurt soll noch da sein. Aber es werden jetzt so viele Juden deportiert. Das sind alles so neumodische Wörter: arisiert, evakuiert, deportiert, Alliierte, Partisanen. Wollen wir hoffen, dass die letzteren über die ersten gewinnen, vor allem Du, mein lieber Jacob.
Viele Grüße von Deinen drei tapfer in die Zukunft schauenden Weibern
Else, Grete und Inge
3
Triest, Januar 1953
Sehr geehrte Frau Ahlers,
mein Name ist Nermin Bosniaković, ich bin ein ehemaliger Kommandeur der Tito-Partisanen, der vor allem verantwortlich war für die Zusammenarbeit mit unseren italienischen Partnern. Deshalb war unser Sitz hier in Triest, unweit der slowenischen Grenze. Einer unserer Kämpfer war Jacob Jacobsohn aus Hamburg. Wir haben ihn alle sehr geschätzt und geliebt, denn er war ein guter Kämpfer. Aber er war nicht gut, weil er gut kämpfen konnte, sondern weil er gut kämpfen wollte. Er war eigentlich Kaufmann und Pazifist, insofern als Partisan ungeeignet. Aber er war auch ein Deutscher, und von daher gründlich, fleißig und gerecht. Und sein Gerechtigkeitssinn sagte ihm, dass Deutschland gerade auf der falschen Seite steht. Er hat uns erzählt, wie er, immer einen Schritt vor seinen Verfolgern, erst seine Tochter, dann seine Frau, also Sie, vor der Verfolgung bewahrt hat. Ich schicke Ihnen alles, ein paar Fotos, seine Aufzeichnungen, Ihre Briefe und wenige Dokumente, alles, was ich von ihm vorgefunden habe. Er hatte in den wenigen Stunden, in denen er Pause hatte, begonnen, seine bemerkenswerte Lebensgeschichte aufzuschreiben, seine Kindheit in der kleinen norddeutschen Stadt Rantzlau als Sohn eines Gerbers. Er liebte wohl seinen Vater, aber er wollte nicht Gerber werden. Dann traf er Sie und alles wurde gut. Aber dann kamen die Faschisten an die Macht, und alles wurde schlecht. Er wich ihnen geschickt aus und traf endlich uns, und alles hätte gut werden können. Er hat für uns übersetzt, er hat uns das Verhalten der deutschen Offiziere und Soldaten erklärt, die deutsche Seele und die deutsche Angst. Wäre er noch ein bisschen länger bei uns geblieben, so hätte er sogar in die deutsche Abteilung, die Telmanovci, eintreten können. Aber er geriet in Triest in einen Hinterhalt und in eine Kontrolle der Wehrmacht und wurde enttarnt. Und dann musste er, der die Bahn so liebte und so gerne Bahn gefahren ist, in den falschen Zug einsteigen. Am 8. Dezember 1943 wurde er, wie wir erst viel später erfahren haben, in Auschwitz ermordet. Friede seiner Asche! Pokoj njegovom pepelu!