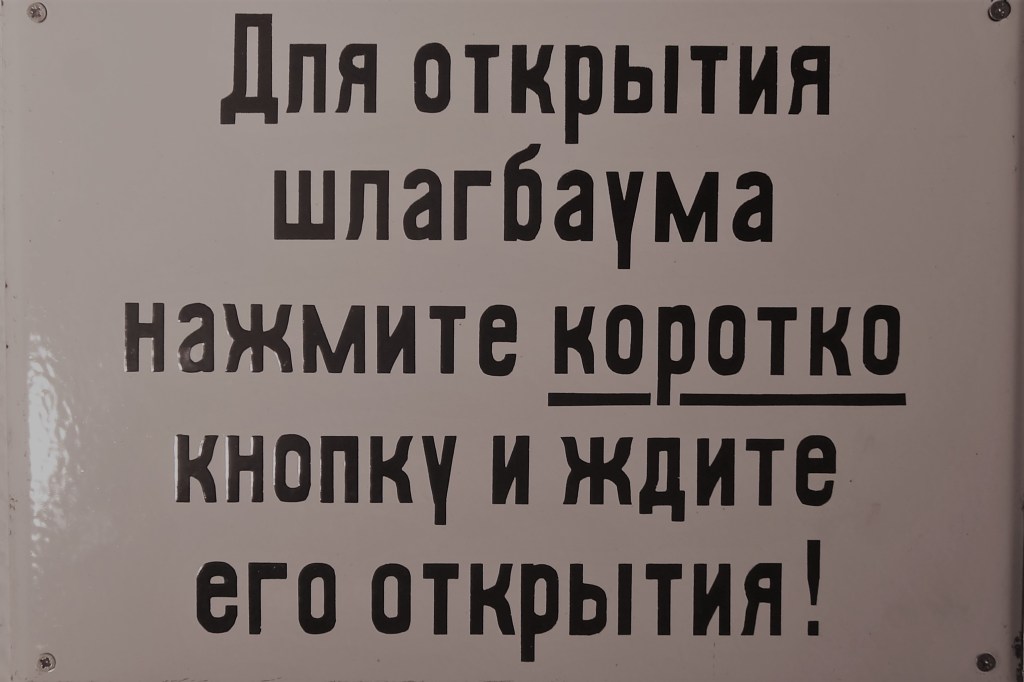1
Ein Paradigmenwechsel ist nur insofern ein Ende, als er auch ein Anfang ist. Alles, was früher galt, gilt auch heute, nur mit einer anderen Wertigkeit, in neuen Zusammenhängen. Man kann mit einem Faustkeil oder mit einem Dreschflegel noch genau das gleiche tun wie früher, nur tut man es jetzt wesentlich seltener. Hegel nannte das Aufgehobensein. Das ist auch eine schöne Erklärung für wahren Konservatismus: die Tradition wahren, das Alte aufheben, ohne das Neue zu verachten. Inzwischen ist aber, da wir erkannt haben, dass jede Innovation auch einen neuen Grad von Zerstörung in die Welt bringt, eine neue Denkgröße hinzugetreten: die Nachhaltigkeit, die relativ neue Vorstellung, dass nicht mehr verbraucht werden kann, als nachwächst oder sich regeneriert. So können wir überlegen, ob der Faustkeil in einer semimobilen Brechanlage funktional gut aufgehoben ist oder ob diese soviel Energie verbraucht, wie durch die neue Straße, die mit den gebrochenen Steinen als Unterbau entsteht, eingespart wird. Dann hätte diese Gleichung eine fette Null als Lösung, das ist der Traum vom Gleichgewicht, aber in Wirklichkeit verbrauchen wir in Deutschland soviel Energie wie ganz Afrika. Das ist ein Verhältnis von achtzig Millionen zu über einer Milliarde Menschen und nicht durch das schlechte Wetter hierzulande hinreichend erklärt. Das ist signifikant nicht nachhaltig, selbst nicht mit Windrädern, denn diese müssen her- und hingestellt und später entsorgt werden, sie beeinträchtigen zudem die Lebensqualität, wenn auch weit weniger als Kohle- oder Kernkraftwerke.

2
Der kleine Kalkant
Die Orgel als Sozialidylle
Erst musste er die Glocken läuten, dann wirkte er als Kalkant an der Sonntagsmusik in seinem Heimatdorf mit. Kalkant, das klingt heute eher nach einem Menschen, der etwas kalkuliert, was wir ja alle tun. Das war aber der Bälgetreter, ein Junge, der vor der Konfirmation, die seine Kindheit im Elternhaus beendete, in der Kirche den Schöpfbalg der Orgel bediente, damit der Lehrer, der auch Kantor war, die Gemeinde begleiten konnte. Vielleicht war der Lehrer auch so gut, dass er jeden Sonntag mit einem Stück konzertierte und brillierte. Zwar brillierte der Kalkant nicht, trotzdem war er unentbehrlich und vergaß auch später nicht, was er da, vielleicht ein bis zwei Jahre lang, getan hatte, wie er glaubte, für Gott, aber, wie wir meinen, auch für die Demokratie, die Kunst und für sein eigenes Verständnis.
Was er nämlich, wenn er diese Tätigkeit beendete, verstanden hatte, war nicht die Musik, die für ihn wahrscheinlich unverständlich bleibende Musiksprache Bachs oder Regers, sondern das Komplementäre seines Tuns: wenn er den Balg nicht trat, konnte der Kantor nicht spielen, spielte der Kantor nicht, musste er auch nicht den Schöpfbalg bewegen. Die Orgeln im frühen neunzehnten Jahrhundert waren alle Meisterwerke der Mechanik. Es gibt einerseits den Weg der Luft von überall durch den Balg in die Pfeife, andererseits den Impuls des Gedankens über die Finger, die Tasten, die Abstrakten ebenfalls zur Pfeife. Dort treffen sich Luftstrom und Gedankenstrom und erzeugen im besten Falle Musik. Die Abhängigkeit des Musikers, der sich als Tastenwanderer und Spintisierer sehen mochte, vom kleinen Jungen, der seine frühe Kraft in den Dienst der Allgemeinheit stellte, diese Abhängigkeit in einem kohärenten System war gegenseitig.
Weil es einem hierarchischen Staats- und Erziehungssystem nicht gelungen ist, den Bälgetreter von der Notwendigkeit und der Sprache dieser Musik zu überzeugen, ist die Luftbeschaffung mechanisiert und die Musiksprache für Bälgetreter krass vereinfacht worden. Zwar gab es auch schon vorher neben der erbauenden die rein unterhaltende Musik und Kunst überhaupt, aber eben daneben und eher als Ausnahme. Die Reproduktionsmöglichkeiten der Kunst und der wachsende Wohlstand führten zur massenhaften Ausbreitung rein unterhaltender Musik, deren Herkunft und Abhängigkeit dem Laien verborgen bleibt, dem Musiker aber eine Selbstverständlichkeit ist: man hört im Jazz den Choral und die Polyphonie, man sieht im Instrumentarium die türkische Militärmusik, zum Beispiel die Percussion, man fühlt in der Klangnachahmung des Synthesizers den Leierkasten und die Kinoorgel. Und die hatte der Dorfschullehrer auch schon erfunden, wenn er den Kindern eine Geschichte erzählte und die dazugehörigen Geräusche auf der Orgel produzierte. Der Lehrer selbst war ein Medium und musste zaubern können.
Aber das sich ergänzende Miteinander bestand nicht freiwillig, sondern in einem autoritären Zwangssystem, auch wenn es den Menschen damals als ganz natürlich und wunderbar erschien. Der Kaiser im Märchen fiel gedanklich mit dem Kaiser in Berlin oder Wien oder Moskau oder Istambul zusammen!
Man könnte Technik auch immer als den Versuch deuten, menschliche Abhängigkeiten und Kraftverschwendung durch Apparaturen zu ersetzen. Denn der kleine Kalkant war nicht immer zuverlässig, einmal war er krank, das andere mal hatte er seinen komplementären Termin schlicht vergessen, beim dritten Mal musste er zu einem ersten Date hinterm Hollerbusch eilen.
Die heutigen Windmaschinen erzeugen einen gleichmäßig hohen Winddruck. Spezialisten für alte Musik spielen schon wieder an Orgeln, deren Winddruck von speziell geschulten, natürlich nicht mehr halbwüchsigen Kalkanten hergestellt wird. Die heutigen Windmaschinen erzeugen aber auch oft einen Höllenlärm, der gedämpft werden muss oder störend bleibt. Kurz: ein jeder Vorteil bringt auch neue Nachteile mit sich, ein Lehrsatz, den wir allzugern vergessen. Auch das Fahrrad war einst erfunden worden, um die Abhängigkeit des Menschen vom Pferd zu mildern. In jenem Jahr ohne Sommer, 1816, starben viele Pferde selbst Hungers oder wurden dem Hunger der Menschen geopfert. Während der Freiherr von Drais als Ersatz für das Pferd das Fahrrad ersann, dachte der junge Justus Liebig, später Freiherr von Liebig, schon über organische Chemie und Düngung, zunächst aber über Knallerbsen nach. Ganz sicher arbeitete er auch als kleiner Kalkant.
Was früher als Kraftverschwendung gedeutet wurde, könnte heute in ein Fitnessprogramm einbezogen sein. Man stelle sich diesen Genuss dickleibiger älterer Damen und Herren vor: sie trainieren sich Pfunde ab und wunderbare Musik an, wenn sie als Kalkanten statt als bloße Zuhörer zum Konzert gehen. Danach besteigen sie ein Fahrrad, das nicht durch einen Elektromotor trittverstärkt, sondern durch einen Dynamo ausgenutzt wird. Die so gewonnene Energie wird zuhause ins Mikrokraftwerk eingespeist. Ein Vorgefühl von diesem späteren Glück kann man schon sommers in der Uckermark sehen: so viele Fahrradfahrer eilen zu Orgelkonzerten!
Das gilt alles nur für kleine Dorforgeln und Fahrräder. Die neue Orgel im Dom zu Speyer hat ein offenes 32-Fuß-Register, für das man soviel Wind braucht, dass eine ganze Schulklasse kalkantisch eingesetzt werden müsste. Das Register heißt Contraposaune, sollte aber zu Ehren der Stifter der Orgel, der Fabrikantenfamilie Quandt, in Quandtarde umbenannt werden. Und weil die Familie nicht nur Automobile der Sorte BMW, sondern auch Waffen produzierte und Zwangsarbeiter beschäftigte, regte sich dagegen demokratischer Protest. Alles Gigantomanische ist kontraproduktiv.
Die Dorforgel wäre aber mit ihrem nahen Verwandten, dem Fahrrad, schon von vornherein demokratisch, wenn sie nicht in so undemokratischer Zeit gestanden hätte. Die Renaissance der Dorforgel in Orgelkonzerten und ganzen Konzertsommern ist also nicht nur unserem Dauerwunsch nach Musik geschuldet, sondern auch der Sehnsucht nach einfachen, aber demokratischen Verhältnissen, nach gegenseitigen Abhängigkeiten, die wohltuend solidarisch sind. Viele Menschen glauben sich heute in einer kalten, fremden Welt, weil sie das Solidarsystem genauso wenig wahrnehmen können wie die Winderzeugung beim sommerlichen Orgelkonzert. Eine kleine Orgel ist heute so demokratisch, sozialromantisch, ökologisch und nachhaltig wie ein Fahrrad.
Bleibt nur noch zu hoffen, dass die Glocken von einem einsamen Rentner, der seinen Lebenssinn darin wiederfindet, oder willigen Hartzvieristen, der einen kleinen Teil dessen, was er der Gesellschaft schuldet, zurückzugeben hofft, geläutet werden, und nicht von einer gott- und seelenlosen energieverbrauchenden Maschine.

3
In einem winzigen Dorf in der menschenleeren Uckermark wird am Reformationstag 2014 eine neue alte Orgel eingeweiht. Früher, im neunzehnten Jahrhundert, war die Orgel eine Schnittstelle zwischen elitärer Kultur und dem so genannten einfachen Volk. Diese Kultur war nicht insofern elitär, als dass sie niemand hätte verstehen können, sondern in dem Sinne, dass sie, mangels Reproduzierbarkeit, selten zu hören und zu sehen war. Wenn sie allerdings stattfand, waren an ihr mehr eingeborene Personen beteiligt als heute. Wir nehmen einmal an, der Dorfschullehrer von Woddow oder Bagemühl hätte sich zum Reformationstag 1814 vorgenommen, einen Bachchoral aufzuführen. Den kräftigsten Schüler hätte er als Kalkanten eingesetzt, die schönsten Stimmen hätten gesungen. Viele hätten mitgemacht. Mädchen denken immer, dass sie gut singen können, Jungen denken meistens, dass sie es nicht können. In einem Bachchoral gibt es keine Hierarchie, alle Stimmen sind gleichverpflichtet, die Orgel muss so laut sein, dass sie jeder hört, aber so leise, dass sie nicht die zarten Stimmen der angeblich groben Dorfkinder übertönt. Wie sollen die Kinder nicht die Schönheit dieses Chorals empfunden haben? Und wie soll das im Gegensatz zur Kirmesmusik gestanden haben, wie man damals Pop nannte? Nur in einer Hierarchie gibt es oben und unten, gut und schlecht. Nach zwei verheerenden Kriegen, die eine Hierarchie der Nationen stützen sollten, brach die internationale Hierarchie zurecht zusammen, aber nicht Freiheit war das Ergebnis, sondern zunächst Chaos. Vandalismus kann nie Freiheit bringen, aber vielleicht doch Befreiung. Gutshäuser wurden angezündet, Kirchen geplündert. Die Gutsherren und die Kirchenfürsten hatten sich zu sehr ins Zerstörungsgeschäft gemischt. Die Pfeifen der Woddower Orgel, wir wissen noch nicht einmal, wer das Werk einst gebaut hatte, wurden, nachdem sie Kindern zum Gespött dienten, als Altmetall verscherbelt und der Rest als Altholz verbrannt. Die Kirche verfiel, ihr Inventar, darunter ein wertvoller mittelalterlicher Altar, wurde ausgelagert. ‚Ach wie flüchtig, ach wie nichtig…‘ ächzten die Fugen des Feldsteinbaus.
Inzwischen war in Berlin durch denselben Krieg zum fünften Mal jene Kirche zerstört worden, die an der ältesten Stelle dieser nicht so sehr alten Stadt gestanden hatte, die Petrikirche. Aber im Gegensatz zu Woddow kam der Krieg nicht als fremdes unverstandenes Schicksal auf Berlin, sondern er war von hier als böses Schicksal für viele Millionen Menschen ausgegangen. Von der ältesten Gemeinde blieb ein Schutthaufen übrig, aber auch Hoffnung in einem Gemeindehaus. Für den weiteren Verfall wird gerne der durch die Diktaturen geförderte Atheismus verantwortlich gemacht, denn das haben wir alle in Hierarchien und Diktaturen gelernt, dass es leichter ist, von äußeren Ursachen auszugehen. In jeder Schuldzuweisung liegt ein falscher Trost. Zum Schluss wurde auch dieses Gemeindehaus verkauft, so dass, nachdem die Petrikirche einst die größte Orgel Berlins besessen hatte (Carl August und Carl Friedrich Buchholz, IV, 60, 1860), die letzte kleine Orgel heimatlos übrig blieb.
Und man möchte beinahe glauben, dass auf wunderbarem Weg sich diese beiden Geschichten trafen. Die Orgel scheint für die gerettete Kirche von Woddow wie gemacht, hier erst entfaltet sie ihren wahren Klang, ungedämpft durch Querelen und Hölzer. Aber für wen wurde die Kirche gerettet? Zunächst wurde sie für die Retter gerettet, die Bewohner des Palindromdorfes und der umliegenden Orte. Sodann aber auch für willkommene Gäste, seien es Verwandte und Bekannte, Touristen und Migranten. Gerade in diesen Dörfern kamen vor dreihundert Jahren französische Glaubensflüchtlinge an, die vielleicht nicht in jedem Falle willkommen waren, zumindest haben sie selbst auch lange gefremdelt, aber dann haben sie sich so sehr integriert und assimiliert, dass ihre Nachkommen heute noch nicht einmal mehr ihre eigenen Namen französisch aussprechen. Die Uckermark ist also auch ein Landstrich der Migration. Vielleicht sollten wir wieder ausrufen, dass Flüchtlinge, aus welchem Grund und Land auch immer, hier jederzeit willkommen sind. Vielleicht wird Woddow dann die erste Moschee mit einer Orgel, noch besser aber: keine Moschee und keine Kirche, sondern ein Haus für alle Menschen haben. Die einen beten – in welchem Kult und in welcher Sprache auch immer – zu Gott, die anderen beraten, was man Gutes für die nächsten Generationen tun kann. Dann hätte die alte Feldsteinkirche von Woddow dieselbe Bestimmung wie der Ort der Petrikirche, wo gerade jetzt ein Tempel der drei monotheistischen oder abrahamitischen Religionen entsteht, das HOUSE OF ONE. Um die Ecke haben übrigens zwei berühmte Pfarrer gewohnt: Gotthold Ephraim Lessing erdachte dort den weisen Nathan und den weisen Saladin und den weisen Tempelherrn, der aus der Hierarchie aussteigt wie aus einem falschen Mantel, und Johann Peter Süßmilch, der übrigens tatsächlich auch Pfarrer an der Petrikirche war, erdachte dort die Statistik als Beschreibung des perfekten göttlichen Wirkens. Er war nicht nur einer der Begründer der Demografie, sondern auch der erste Denker, der Evolution und Glauben zusammenbrachte, ein gottnaher Mathematiker.
4
Die Nachhaltigkeit einer mechanischen Orgel erklärt sich aus ihrem Material, Kiefernholz, Eichenholz, Kupfer, Blei, Zinn und Zink, wie aus ihrer robust mechanischen Bauweise und Zweckbestimmtheit. All das wirkt in Dauerhaftigkeit und Verlässlichkeit zusammen. Eine Orgel besteht sicher hundert und zweihundert, oft dreihundert und vierhundert Jahre. Sie muss allerdings gepflegt und benutzt, gewollt und gemocht sein. Solange die Kirche das Monopol und den Primat im menschlichen Lebenslauf hatte, war also auch die Orgel, wo sie überhaupt vorhanden war, allgegenwärtig. Bis in das Denken und die Sprache hinein war sie zu hören: Kinder wie die Orgelpfeifen, denen man die Flötentöne schon beibringen wird, wo du nicht bist, Herr Organist, da schweigen alle Pfeifen, alle Register ziehen, den Riemen auf die Orgel werfen, die Pfeife spricht oder ist blind, zu der Orgel gehören andere Bälge, draußen orgelt der Wind. Fast jede Orgel hat viele Generationen von Menschen erlebt, fast jede Kirche hat mehrere Generationen Orgeln gehört. Konkurrenz hat die Orgel in dieser Beziehung zum Menschen nur im neunzehnten Jahrhundert vom Harmonium und vom Wohnzimmerklavier bekommen. Ansonsten steht sie einzig da: das Musikinstrument, das die meisten Menschen in vielen Jahrhunderten begleitete. Nachhaltigkeit ist also keineswegs nur eine Materialfrage. Vielmehr kann man von einer Prägung der abendländischen Bevölkerung sprechen. Sprechen die Glocken mehr als Signal, so kann die Orgel Gefühle kommentieren und sogar hinterfragen. Die Symbiose des europäischen Menschen mit der Orgel wies aber auch in die Zukunft: Jeder kleine aufmerksame Kalkant wusste schon im neunzehnten Jahrhundert, was programmieren ist: eine Melodie oder Harmonie als Software und eine Flöte oder Trompete als grundlegende Hardware zusammenbringen. Dieses Prinzip wurde in der weitgehend verachteten Drehorgel noch weitergeführt, so dass man sagen kann, der Lochstreifen des Zuse-Computers ist die legitime Tochter der Walze von Drehorgeln oder der Lochplatten von anderen mechanisch-automatisierten Instrumenten.
Ist die Musik uns emotional am nächsten, so ist es das Haus rational. Beide treffen sich im Ton. Die mit Abstand meisten Orgeln stehen in Gotteshäusern. Es gab eine ganz kurze Periode von Kinoorgeln, die allerdings schnell durch den Tonfilm abgelöst wurde. Dennoch ist die Verwandtschaft der Kultorgeln in Kirchen und Kinos nicht zu übersehen. Die Allgegenwart des christlichen Kultus erscheint im zwanzigsten Jahrhundert abgelöst durch die Allgegenwart narrativer Medien. Wenn man noch die unvermeidliche Globalisierung hinzudenkt, ist die Angst vor Synkretismus unverständlich bis lächerlich. Alle Reinheitsvorstellungen sind notwendig absurd. Es gibt keine hundert Prozent. Alle Balken brechen nach dem Muster der Eulerschen Knickfälle und alle aufeinandertreffenden Systeme bilden Schnittmengen nach Venn, auch er übrigens ein Pfarrer.
Kultische Häuser sind einerseits Versammlungsstätten, Orte der Gruppen. Andererseits aber zeigt ihre Anzahl, ihr Raum und der Ort, auf dem sie stehen, an, dass sie gleichzeitig Symbole der Transzendenz sind. Jeder Mensch fühlt, dass es eine höhere Kraft als ihn selbst und die Summe von seinesgleichen gibt. Selbst wenn wir das moralische Gesetz, das Kant unter dem gestirnten Himmel spürte, als Kindchenschema oder gar als biochemische Schutzreaktion der Arterhaltung deuten, ist uns klar, dass dahinter eine höhere Rettungsmacht steht, die sozusagen naturwidrige Wunder vollbringt: der gefürchtete Wolf zieht ein Menschenbaby auf und umgekehrt. Der Wolf löst gleichzeitig Furcht und Nähe aus. So ist auch das Verhältnis von Technik und Leben: sie schließen sich gleichzeitig ein und aus. Heute ist uns erst klar geworden, wer in diesem Wettstreit letztendlich obsiegen wird. Ganz ähnlich wirken die von uns so genannten Gotteshäuser auf uns, weil wir wollen, dass etwas so auf uns wirkt. Wir spüren Gott, weil wir im gotischen Dom oder in der prächtigen Moschee Gott spüren wollen und sollen, der Architekt baut, was wir alle fühlen. Wir alle fühlen hinter den Feldsteinmauern, die durchaus auch den Regeln von Feuchte und Moder gehorchen, das Übernatürliche.
Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Alle Hochrechnungen sind letztlich falsch. Als man von Telepathie träumte, wurde das Telefon erfunden, kurz darauf die die Television. Zwar spinnen wir Luftgespinste (empty visions), wie es in einem der schönsten Lieder heißt, aber selbst der felsenfesteste Fundamentalist wird zugeben müssen, dass doch nicht nur eine erstaunliche Anzahl von leeren Visionen Wirklichkeit wurde, sondern auch auf höchst erstaunlichen Gebieten. So sind wir selbst als Körper hochmobil, aber noch schneller sind unsere Gedanken. In wenigen Sekunden sind sie in Amerika oder Australien. Aber braucht sie dort jemand, fragte schon Samuel Morse?
Je schneller unser Leben zu sein scheint, desto mehr Entschleunigung benötigen wir. Man kann nach Schweden fahren oder in die Feldsteinkirche Woddow gehen, denn alles, was früher galt, gilt auch heute, wenn auch mit einer anderen Wertigkeit.
5
Also, wozu brauchen wir diese Orgel?
So wie das Kreuz die Zusammenführung zweier Linien ist, so ist die Orgel in gewisser Weise ein Symbol für das Abendland, für alles, was gestern war und von dem wir fürchten, dass es morgen nicht mehr sein wird. Unsere eigene Angst vor der Vergänglichkeit, von der die Fugen des Feldsteinmauerwerks singen, wird in der Bewahrung aufgehoben. Unser Leben hat nur Sinn auf andere Menschen hin, so wie wir von anderen Menschen leben, leben wir auch für sie. Wenn wir also etwas bewahren, tun wir es gerade auch für andere Menschen, Generationen und sogar Nationen.
Und obwohl diese Feldsteinkirche, die nach 69 Jahren Schweigen wieder eine Orgel hat, ein doppeltes und dreifaches Symbol für das Abendland ist, ist sie gerade durch ihre Leere, durch ihr Verwurzeltsein im leeren Raum, in einer Landschaft, die nahezu menschenleer ist, offen für alles Neue, ob es nun Flüchtlinge sind oder elektronische Gedankenstützen und Gefühlsreproduzenten. In der Feldsteinkirche aus dem dreizehnten Jahrhundert wohnte schon immer die Hoffnung und wohnt sie wieder. Nur wenige Touristen eilen durch unser abgelegenes Brüssower Land. Aber wenn in jedem Jahr einer darunter ist, der hier Entschleunigung und Trost findet, Stille und einen neuen Gedanken, dann hat es Sinn gehabt, die Schukeorgel opus 278 aus dem verkauften Petrigemeindesaal der fünfmal zerstörten ältesten Kirche Berlins, dort wo jetzt das HOUSE OF ONE gebaut wird, ganz in der Nähe vom Geburtsort des weisen Nathan, in das fast schon verlassene Dorf in der menschenleeren Uckermark zu bringen, in die Kirche, die schon aufgegeben und vergessen war, an die Stelle der Orgel, an die sich niemand erinnert…
Jedes Dach ist ein Obdach und jede Melodie ist Heimat.